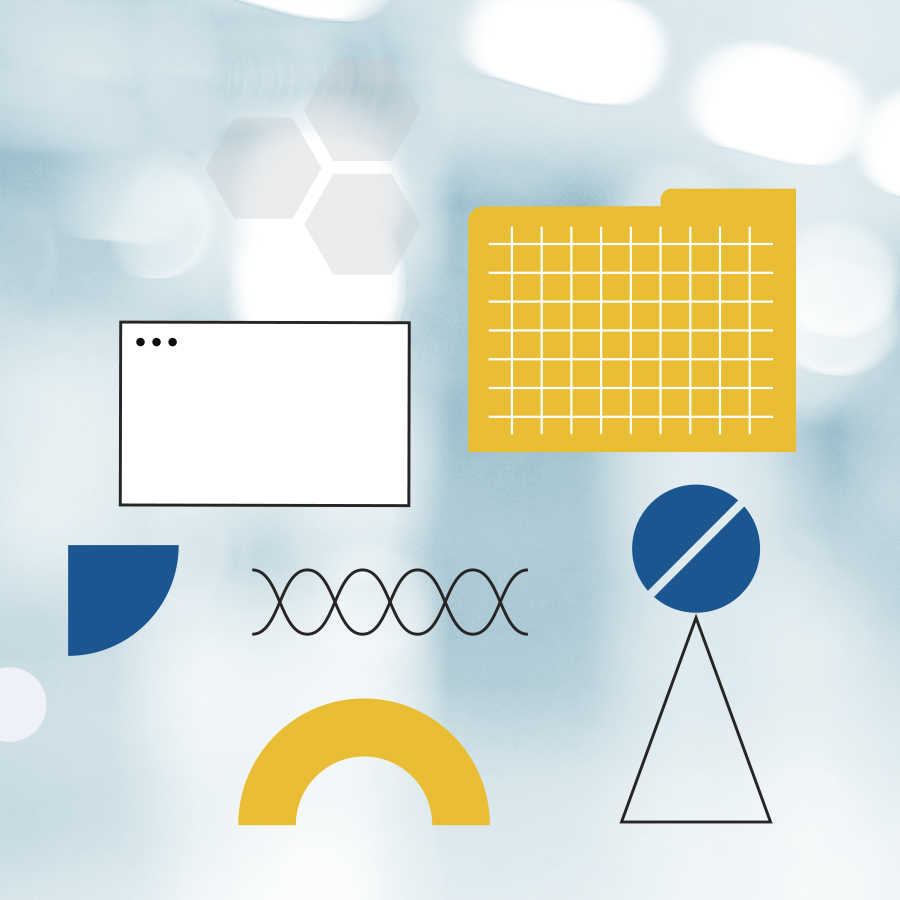-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Expertise
Publication
PFAS Regulation and Development at the European Level with Focus on Germany and France
Publication
The CrowdStrike Incident – A Wake-Up Call for Insurers?
Publication
Decision-Making in the Age of Generative Artificial Intelligence
Publication
Buildings Made of Wood – A Challenge For Insurers?
Publication
Cat Bonds – A Threat to Traditional Reinsurance? -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
Gen Re’s valuable insights and risk transfer solutions help clients improve their business results. With tailor-made reinsurance programs, clients can achieve their life & health risk management objectives.
UnderwritingTraining & Education
Publication
Fasting – A Tradition Across Civilizations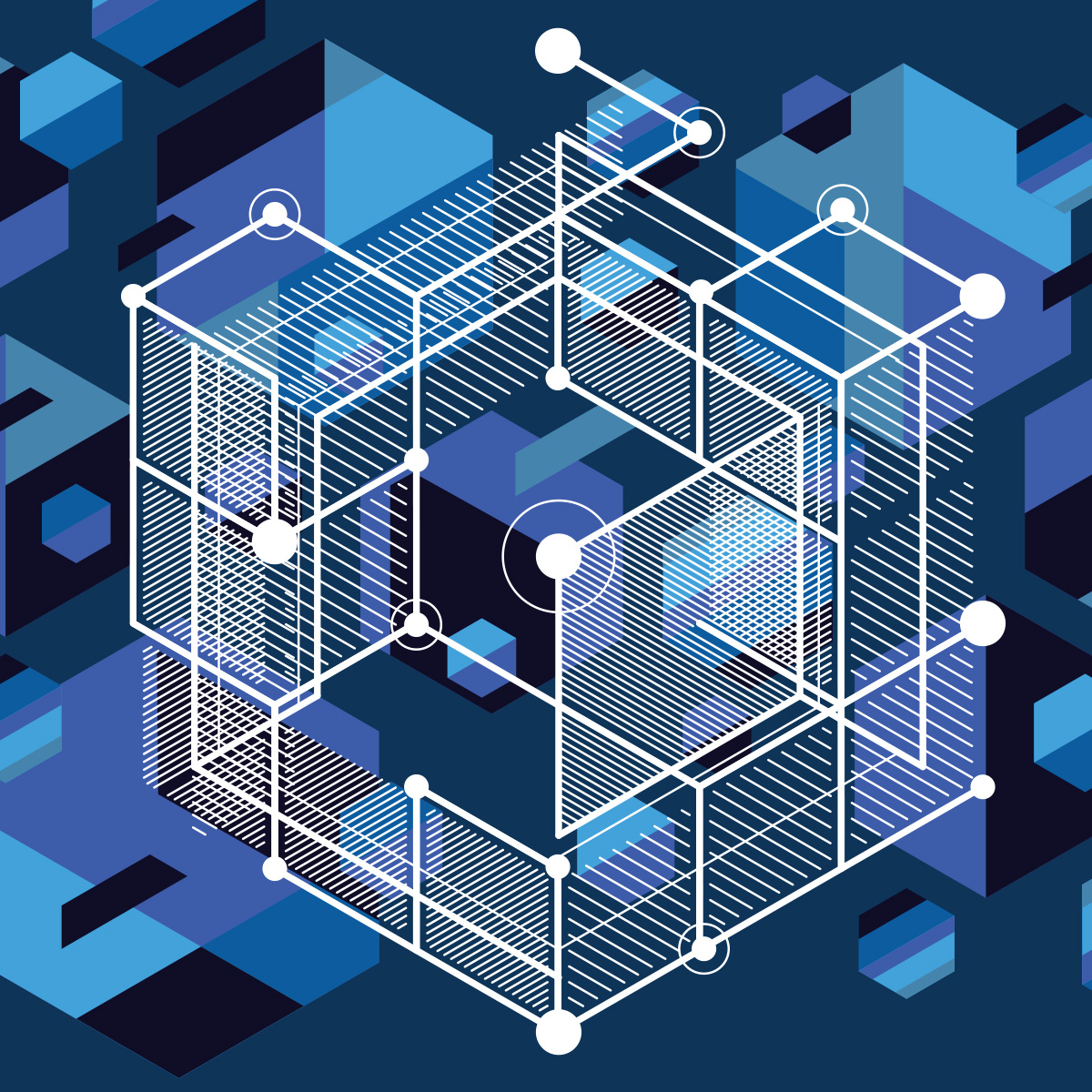
Publication
When Actuaries Meet Claims Managers – Data-Driven Disability Claims Review Business School
Business School
Publication
Chronic Pain and the Role of Insurers – A Multifactorial Perspective on Causes, Therapies and Prognosis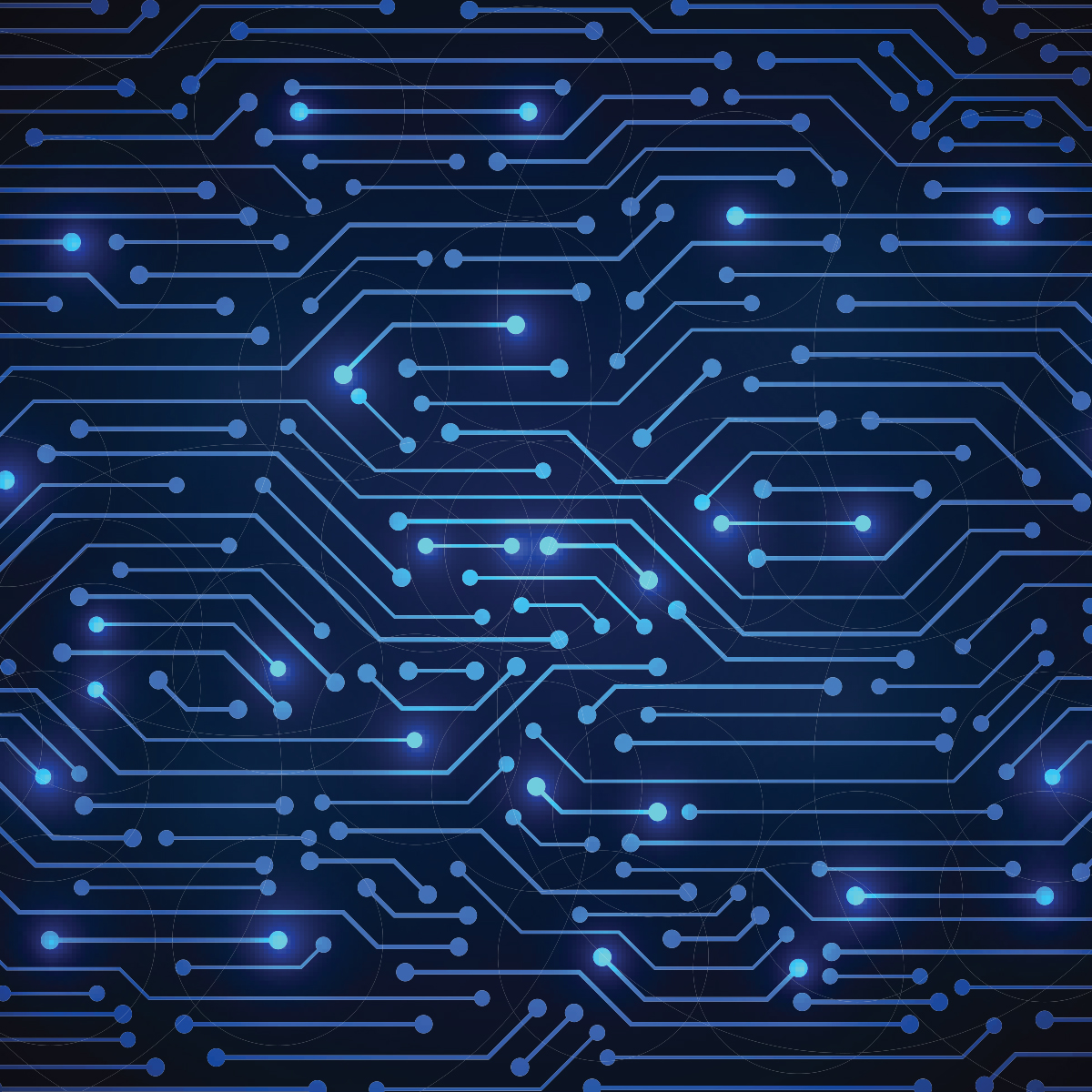
Publication
Simplicity, Interpretability, and Effective Variable Selection with LASSO Regression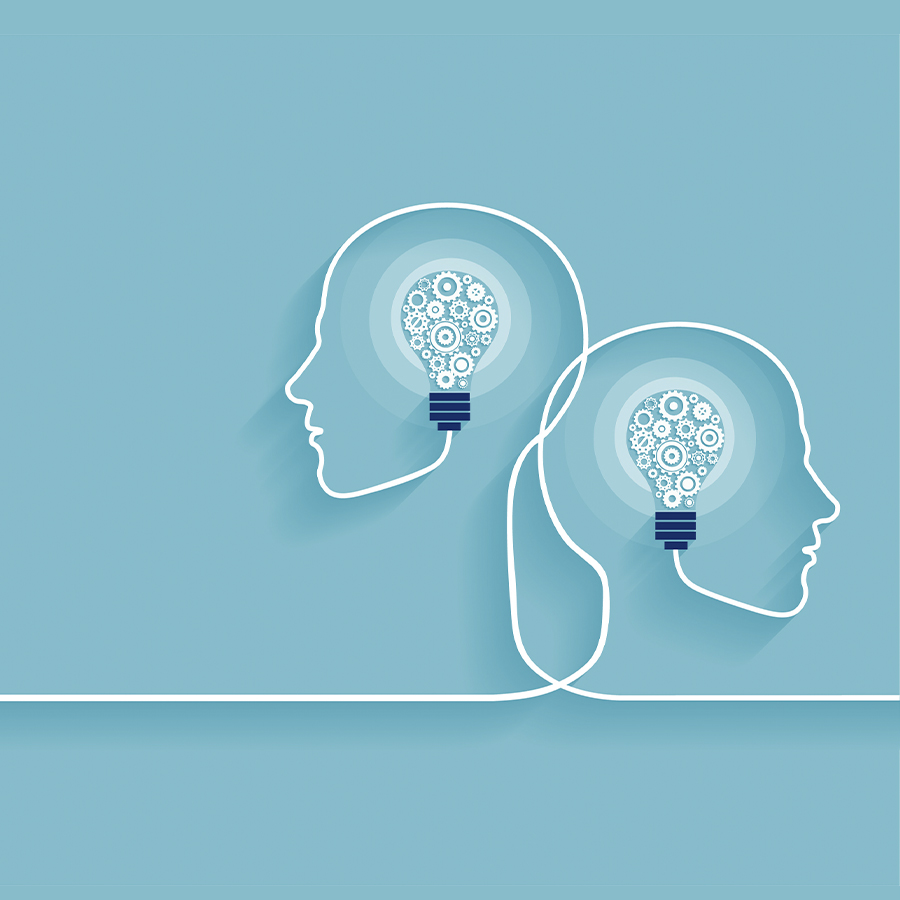 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
Eine neue Erkrankung – Underwriting ohne Evidenz

Anforderungen evidenzbasierter Risikoprüfung
Heutige Underwriting-Regeln folgen den Prinzipien der evidenzbasierten Risikoprüfung. Durch Einhaltung dieser Prinzipien stellen Versicherungsunternehmen sicher, dass alle von Risikoprüfern vorgenommenen Einschätzungen eine solide statistische Basis haben. Dies gilt vor allem für die Einschätzung eines Antragstellers als erhöhtes Risiko, so dass ein Risikozuschlag, ein teilweiser Risikoausschluss oder sogar die Ablehnung des Antrages erforderlich wird.
Dass risikoprüferische Einschätzungen evidenzbasierterfolgen, ist aus (mindestens) zwei Gründen unabdingbar:
- Erstens wird dadurch gewährleistet, dass die Risikoprüfungs-Entscheidung einen angemessenen Ausgleich für das Risiko schafft, das der Versicherer durch die Annahme des Antragstellers übernimmt.
- Zweitens schreibt der Gesetzgeber vor, dass Risikoentscheidungen auf Grundlage adäquater und ausreichender Evidenz getroffen werden müssen. Nur so können Versicherungsunternehmen die gesetzlichen Anti-Diskrimierungsanforderungen erfüllen.
Wo die Erfahrung aus dem eigenen Portfolio nicht ausreicht, basiert die Bewertung medizinischer Risiken insbesondere auf klinischen Studien und Statistiken. Deren Auswahl erfolgt anhand von bewährten Kriterien nach Qualität und Relevanz für das zu bewertende Risiko. Ob eine klinische Studie für Einschätzungsrichtlinien als geeignet gilt oder nicht, hängt von einer Vielzahl von Parametern ab. Die wichtigsten davon sind:
- Dauer der Nachbeobachtung: Nur Studien mit einer ausreichend langen Nachbeobachtungsdauer erlauben eine langfristige Prognose, die für Lebensversicherungszwecke erforderlich ist.
- Studienteilnehmer: Zudem muss die Studie bestimmte Anforderungen in Bezug auf die Gruppengröße und die Probanden erfüllen; d. h., die Studie muss entweder für ein zu versicherndes Kollektiv repräsentativ sein oder die Studienergebnisse müssen, wenn auch angepasst, auf ein solches Kollektiv übertragbar sein.
Die Anwendung klinischer Studienergebnisse auf den Versicherungskontext ist Aufgabe multidisziplinärer Expertenteams, die alle relevanten medizinischen, versicherungsmathematischen und rechtlichen Anforderungen in Erwägung ziehen. In die konkrete Ausgestaltung der Einschätzungsrichtlinien fließt die langjährige Berufserfahrung von Medizinern und Underwritern ein. Diese Erfahrung ergänzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse und ermöglicht so die Entwicklung risikoadäquater Richtlinien, die sowohl technisch korrekt als auch praktisch anwendbar sind.
Vor dem Hintergrund der Anforderungen der evidenzbasierten Risikoprüfung erscheint das Auftreten einer neuen Krankheit auf den ersten Blick wie ein unüberwindbares Hindernis – denn selbstverständlich fehlt es hierbei sowohl an klinischer als auch an versicherungstechnischer Erfahrung. Und selbst wenn einige frühe klinische Studien vorliegen, sind die Fallzahlen zumeist klein und die Beobachtungszeiträume kurz. Heißt das, dass die Anforderungen der risikoadäquaten und evidenzbasierten Risikoprüfung in diesen Fällen nicht erfüllt werden können?
Risikoprüfung mit wenig Evidenz
Die Entdeckung eines neuartigen Virus wie SARSCoV2 ist ein außergewöhnliches Ereignis. Noch außergewöhnlicher ist es, dass das Virus von unmittelbarer globaler Bedeutung ist. Auch aus Sicht der Risikoprüfung ist dies alles andere als Alltag.
Als Anfang 2020 die ersten Fälle des neuartigen Virus auftraten, hatte noch niemand eine wirkliche Vorstellung davon, was kommen würde. Für uns als Versicherungswirtschaft war es deshalb zu Beginn der Pandemie von höchster Priorität, die Entwicklungen genau zu beobachten und ihre Relevanz für unsere Branche kontinuierlich zu bewerten.
Mit steigenden Fallzahlen ging es darum, möglichst viel über das neuartige Virus in Erfahrung zu bringen und – wenn auch nur vorläufige – Annahmen über die damit verbundenen Risiken zu treffen. Dementsprechend ist es kein Wunder, dass zunächst mehr Fragen auftauchten als Antworten gegeben werden konnten. Als Orientierung, wie dieses Problem aus Sicht der Risikoprüfung angegangen werden könnte, trugen wir dennoch alle noch so geringfügig erscheinenden Belege zusammen und zogen bestmögliche Schlüsse auf ungewohnt und unangenehm unsicherer Basis. Die Herausforderung war einzigartig für uns.
Andererseits ist es durchaus nicht ungewöhnlich, Risikoprüfungs-Entscheidungen auf Grundlage von geringer, unvollständiger oder nur teilweise passender Evidenz getroffen werden müssen. Denn vor eben diesem Problem stehen Risikoprüfer auch bei seltenen Erkrankungen. Von solchen Krankheiten sind nämlich weltweit nur sehr wenige, mitunter nur wenige Hundert Menschen betroffen. Folgende Gründe können eine Risikoprüfungs-Entscheidung bei einer solchen Patientengruppe erschweren:
- Erkrankungen, von denen nur wenige Menschen betroffen sind, werden oft kaum erforscht. Dementsprechend sind in der Regel nur sehr wenige oder gar keine klinischen Studien dazu veröffentlicht worden. Die Studien, die existieren, können qualitativ gut, aber auch veraltet oder sogar verzerrt sein. In Ermangelung alternativer Belege müssen sie dennoch zur Herleitung von Risikoprüfungs-Einschätzungen herangezogen werden.
- Wenn Verlauf und Ausgang einer Erkrankung unter den Betroffenen eine erhebliche Bandbreite aufweisen, ist es für den Risikoprüfer kaum möglich, einen typischen Verlauf zuverlässig zu prognostizieren. Anders als bei häufiger auftretenden Erkrankungen haben individuelle Verläufe in diesem Fall einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Annahmen über das Risiko der betroffenen Gruppe.
- Die Behandlung seltener Krankheiten ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden. Ist das der Fall, können Zugang zu und Bezahlbarkeit von Therapien entscheidende Faktoren für das Überleben und gegebenfalls die Genesung eines Patienten sein. Risikoprüfer können nur schwer vorhersagen, ob ein einzelner Antragsteller für den gesamten erforderlichen Zeitraum die optimale Behandlung erhalten wird.
- Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Versicherungsmediziner in ihrem klinischen Alltag bereits Patienten mit der jeweiligen Erkrankung begegnet sind.
- Darüber hinaus können Versicherungsunternehmen keine Erkenntnisse aus früheren Fällen ziehen, da solche wahrscheinlich nicht existieren, schon gar nicht in ausreichender Zahl.
Wie können in solchen Fällen dennoch faire und angemessene Entscheidungen getroffen werden?
Wie man Entscheidungen unter Unsicherheit trifft
Die Ausgestaltung von Einschätzungsrichtlinien mit begrenzter Evidenz wird stets ein hochkomplexer und individueller Prozess sein. Manche Schritte in diesem Prozess bleiben jedoch immer gleich.
Etablierte Prozesse zu haben, ist besonders hilfreich, wenn noch vieles – wie zu Beginn der COVID‑19-Pandemie – ungewiss ist. In diesen Situationen ist es wichtiger denn je, sich auf die vorhandenen Fakten zu konzentrieren und bewährte Abläufe zu befolgen.
Zu Beginn sollten folgende Fragen gestellt werden:
- Was ist über die Krankheit bekannt?
- Lassen sich Gemeinsamkeiten zu anderen, bereits bekannten Krankheiten erkennen?
- Welche Informationsquellen können für die Bewertung herangezogen werden?
- Wann sollten wir unsere Annahmen ändern?
- Was wissen wir nicht?
Was ist über die Krankheit bekannt?
Anstatt den Fokus zu sehr auf das zu legen, was unbekannt ist, sollte man sich zuerst auf die bekannten Fakten konzentrieren. Selbst bei einer neuartigen Erkrankung wie COVID‑19 liegen stets solide Informationen vor, z. B.:
- Wodurch wird die Krankheit ausgelöst?
- Im Falle einer Viruserkrankung: Ist das Virus, das die Krankheit auslöst, bekannt oder handelt es sich um einen neu entdeckten Erreger?
- Im Falle einer übertragbaren Krankheit: Wie erfolgt die Übertragung?
- Welche Symptome wurden im Krankheitsverlauf festgestellt?
- Lässt sich ein typischer Verlauf beschreiben?
- Wie lässt sich dieser Verlauf mit dem typischen Verlauf verwandter Krankheiten vergleichen?
- Welche Organe sind auf welche Weise durch die Erkrankung betroffen?
- Wie reagiert die Krankheit auf verschiedene therapeutische Maßnahmen?
- Welche Komplikationen wurden beobachtet?
- Unterscheiden sich die Krankheitsverläufe bei unterschiedlichen Patientengruppen deutlich voneinander, z. B. bei Männern und Frauen, nach Alter, oder bei Patienten mit und ohne Vorerkrankung?
Diese Informationen liefern erste, aber bereits sehr wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf das Risiko.
Lassen sich Gemeinsamkeiten zu anderen, bereits bekannten Krankheiten erkennen?
Jede Erkrankung weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit anderen Krankheiten in Bezug auf ihre Symptome und Auswirkungen aus. Diese zu erkennen und zu verstehen, kann bei der Ermittlung des Risikoprofils einer neuen Erkrankung für Risikoprüfungs-Zwecke äußerst hilfreich sein.
Speziell für SARSCoV2 und der dadurch ausgelösten Erkrankung COVID‑19 gibt es z. B. die folgenden Parallelen zu anderen Krankheiten:
- SARSCoV2 ist ein Coronavirus, von denen schon einige bekannt sind. Zwei davon, SARSCoV1 und MERSCoV, haben ihrerseits Epidemien ausgelöst. Zu beiden Krankheiten und den jeweiligen Ausbrüchen liegen umfassende Forschungsergebnisse vor, die wertvolle Erkenntnisse über die grundlegenden Mechanismen von Coronaviren liefern.
- Keines der Symptome von COVID‑19 – die von klassischen Grippe- oder Erkältungssymptomen wie Husten und Schnupfen bis hin zu Atembeschwerden, Fieber und neurologischen Symptomen reichen – tritt nur bei COVID‑19 auf, d. h. sie werden regelmäßig auch bei anderen Erkrankungen beobachtet. Folglich sind die unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen ausführlich beschrieben.
- Einige der schwerwiegenderen Komplikationen, z. B. Lungenentzündung, Lungenembolie, Schlaganfall oder sogar Organversagen – beispielsweise von Leber oder Lunge – können auch von anderen schweren Erkrankungen ausgelöst werden. Aufgrund der Erfahrungen mit diesen Krankheiten lassen sich der langfristige Verlauf und Ausgang besser prognostizieren.
- In den schwersten Fällen von COVID‑19 kann eine intensivmedizinische Behandlung und die künstliche Beatmung des Patienten erforderlich sein. Eine solche Therapie kann langfristige Gesundheitsschädigungen bei Genesenen wie respiratorische, neurologische, aber auch psychische Störungen nach sich ziehen, die die Auswirkungen der eigentlichen Erkrankung verstärken. Diese Folgen treten ebenfalls nicht nur bei der Behandlung von COVID‑19 auf, sodass man die Bewertung auf umfangreiche klinische Erfahrung stützen kann.
- Eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf COVID‑19 ist: „Bei welchen Menschen ist das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs am höchsten?“ Gleich zu Beginn der Pandemie hatten verschiedene Gesundheitseinrichtungen Informationen zu möglichen Hochrisikogruppen herausgegeben. Diese Informationen basierten auf dem damaligen Wissensstand über COVID‑19, aber auch auf jahrelanger Erfahrung mit ähnlichen Erkrankungen. Tatsächlich haben sich die entsprechenden Empfehlungen und Richtlinien als sehr zutreffend herausgestellt, sodass sie im Laufe der Zeit nur geringfügig angepasst und ergänzt werden mussten.
Welche Informationsquellen können für die Bewertung herangezogen werden?
Wie bereits erwähnt, gehört die Auswahl geeigneter Belege zu den wichtigsten Schritten bei der Entwicklung evidenzbasierter Einschätzungsrichtlinien. Ist nur wenig Evidenz verfügbar, fällt diese Auswahl leicht, jedoch mag das Ergebnis nicht immer zufriedenstellend ausfallen.
Im Fall von COVID‑19 besteht die Herausforderung nicht in einem allgemeinen Mangel an Evidenz, sondern in einem Mangel an Langzeitdaten. Im Gegensatz dazu war und ist die Menge der verfügbaren Kurzzeitdaten rekordverdächtig.
Dazu gehören zahlreiche klinische Studien. Seit Pandemiebeginn werden scheinbar im Minutentakt neue Studien veröffentlicht. Auch wenn die Studienqualität hoch ist, beziehen sie sich häufig nur auf geringe Fallzahlen. Viele wurden zudem in einer vorläufigen Studienphase veröffentlicht, um die Erforschung dieser neuartigen Erkrankung zu beschleunigen. Auch wenn dies im Sinne des wissenschaftlichen Fortschritts vernünftig ist, braucht es Langzeitbelege für belastbare Risikoprüfungsentscheidungen.
Neben klinischen Studien erleben wir eine Flut von weiteren, häufig spontan veröffentlichten Informationen:
- Aussagen von zahlreichen – tatsächlichen oder selbst ernannten – Experten
- Berichte von Krankenhäuser oder Ärzten, die an der Behandlung von COVID‑19-Patienten beteiligt waren, häufig mit sehr individuellen Beobachtungen
- Persönlich gefärbte „Augenzeugenberichte“ von Genesenen oder von Angehörigen Verstorbener
- Millionen von Zeitungsartikeln von sehr unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichem Informationsgehalt
Bei diesen Informationsquellen besteht die eigentliche Herausforderung nicht allein in der Sichtung der enormen Mengen, sondern vor allem in der Entscheidung, welche dieser Quellen vertrauenswürdig sind. Die folgenden Kriterien helfen bei der Auswahl:
- Wer ist der Autor der Informationen?
- Was war der Grund für die Veröffentlichung?
- Ist der Autor qualifiziert, sich zum betreffenden Thema zu äußern?
- Wann wurden die Informationen veröffentlicht?
- Wurden die Informationen einer Qualitätsprüfung und/oder PeerReview unterzogen?
- Handelt es sich um die originale Quelle oder lediglich um eine Wiedergabe?
Wann sollten wir unsere Annahmen ändern?
Sowohl bei einer sehr geringen Datenlage (z. B. bei seltenen Erkrankungen) als auch bei einer ständig sich weiterentwickelnden Datenlage (wie bei neu entdeckten Krankheiten) hat jede neue Information das Potenzial, unser Wissen über eine Krankheit grundlegend zu verändern. Beide Situationen erfordern deshalb ein regelmäßiges und gründliches Monitoring neuer Erkenntnisse.
Dabei ist es ebenso unangemessen, auf jede neue Information sofort zu reagieren, wie, neue Belege einfach zu ignorieren. Aus diesem Grund braucht es einen genauen Auswahlprozess, um zu entscheiden, ob neue Erkenntnisse hinreichend bedeutsam sind, um zu einer Veränderung der Gesamtstrategie zu führen.
Was wissen wir nicht?
Letztlich ist es bei der Risikobewertung einer neuen Erkrankung auch wichtig, sich klarzumachen, was (noch) unbekannt ist und was wir vielleicht niemals wissen werden. Diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, da sie die Spielregeln buchstäblich über Nacht verändern können, sodass es nötig sein kann, die Risikoprüfungs-Strategie sehr kurzfristig anzupassen.
Risikobewertung bei COVID‑19
Insbesondere bei der Ausgestaltung von Einschätzungsrichtlinien für medizinische Risiken ist es zudem entscheidend, den Blick nicht ausschließlich auf die betreffende Krankheit zu richten. In vielen Fällen müssen andere Faktoren mit berücksichtigt werden, die bei der Risikoermittlung eine wesentliche Rolle spielen. Gerade im Fall von COVID‑19 gibt es gleich mehrere solcher Aspekte.
Der politische Faktor
Staatliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben den Verlauf der Pandemie stark beeinflusst. Regionale Unterschiede in den Fallzahlen aber auch der Sterblichkeitsrate können sich zu einem erheblichen Grad nur den jeweils ergriffenen Maßnahmen erklären lassen. Diese reichen von Social Distancing bis strengen Ausgangssperren, von Maskenpflicht bis zur Schließung nationaler Grenzen. Die Anpassung der politischen Strategie hat in einigen Regionen zu erheblich unterschiedlichen Verläufen einer ersten und folgender Pandemiewelle geführt.
Dies wird sich zwangsläufig nicht nur auf den allgemeinen Pandemieverlauf, sondern auch auf das individuelle Risiko auswirken. Denn es entscheidet in erheblichem Maße über die mögliche Exposition von Versicherungsnehmern gegenüber dem Virus, aber auch über die Verfügbarkeit medizinischer Behandlungen im Fall einer Ansteckung.
Der menschliche Faktor
Aktuell sind Menschen weltweit mit einem historischen Ereignis konfrontiert. Das gilt nicht nur für diejenigen, die selbst erkrankt sind oder Krankheitsfälle in der Familie oder im Freundeskreis erlebt haben, sondern letztlich für alle, da sich jeder infizieren kann und von den nationalen Eindämmungsmaßnahmen betroffen ist.
Unter diesen Umständen spielt menschliches Verhalten eine entscheidende Rolle in der Ermittlung des individuellen Risikos. Wie genau hält sich der Einzelne an die empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen? Und wie leicht ist es angesichts individueller Lebensbedingungen (z. B. Wohnverhältnisse, Beruf und Familie) für den Einzelnen, das Ansteckungsrisiko zu vermeiden? Auch wenn wir niemals versuchen werden, Mutmaßungen über das Verhalten Einzelner anzustellen, um auf dieser Basis Risikoprüfungs-Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, diese Faktoren bei der Entwicklung einer allgemeinen Risikoprüfungs-Strategie für COVID‑19 im Hinterkopf zu behalten.
Medizinische Faktoren
Aus medizinischer Sicht gibt es drei sehr unterschiedliche Entwicklungen, die das mit der Erkrankung verbundene Risiko potenziell erheblich beeinflussen:
- Neue Therapien können den Ausgang der Krankheit erheblich verbessern.
- Wirksame Impfstoffe können viele Menschen vor einer Erkrankung schützen.
- Mutationen können die mit dem Virus verbundenen Risiken erheblich beeinflussen – sowohl positiv als auch negativ.
All diese Faktoren können signifikante Auswirkungen auf das individuelle Risiko haben.
Fazit
Die COVID‑19-Pandemie hat die Welt in enorme Ungewissheit gestürzt und stellt nach wie vor eine beispiellose Herausforderung auch für die Versicherungswirtschaft dar.
Andererseits gehört der Umgang mit Unsicherheit für Versicherungsunternehmen zum Tagesgeschäft. Dementsprechend verfügen wir als Versicherungswirtschaft über bewährte Prozesse und Verfahren, die selbst unter herausfordernden Umständen angewendet werden können.
Für die Risikoprüfung in der Lebens- und Krankenversicherung bedeutet dies in erster Linie, die Erfahrungen zu identifizieren, auf denen wir aufbauen können, und gleichzeitig darauf vorbereitet zu sind, bestehende Prozesse anhand neuer Informationen anzupassen. So können Risikoprüfungs-Entscheidungen getroffen werden, die unseren Anforderungen an eine risikoadäquate und evidenzbasierte Risikobewertung in dem Maß entsprechen, wie dies unter solchen außergewöhnlichen Umständen möglich ist.