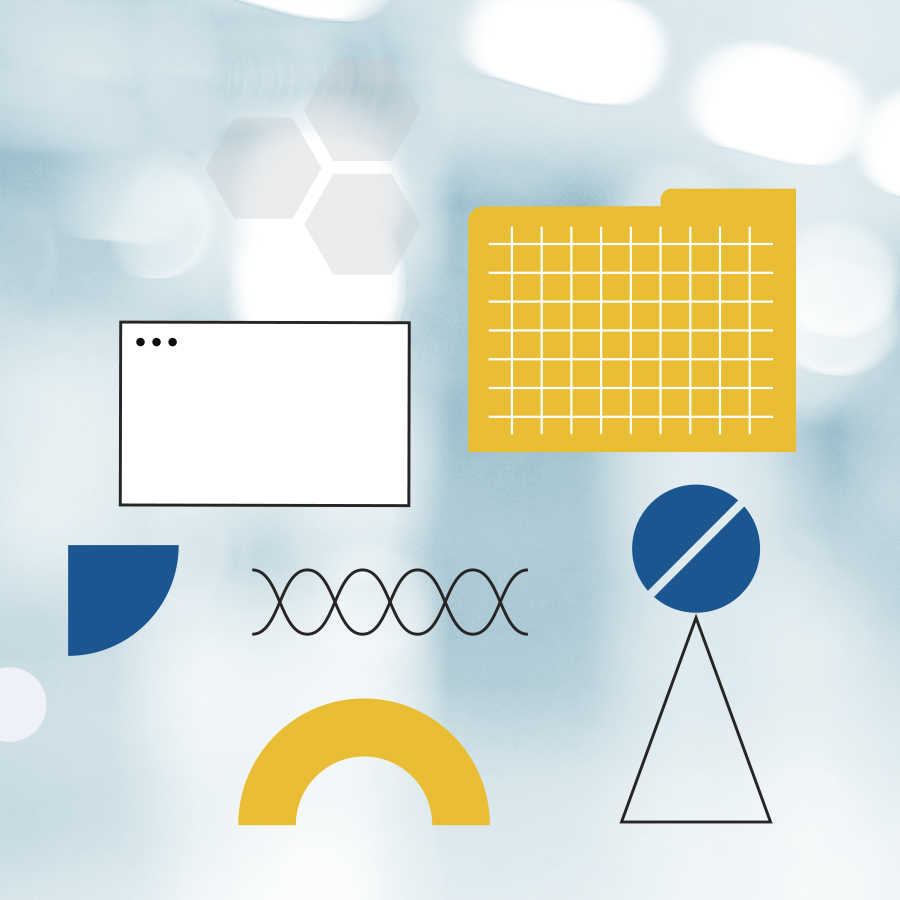-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Expertise
Publication
Secondary Peril Events Are Becoming “Primary.” How Should the Insurance Industry Respond?
Publication
PFAS – Rougher Waters Ahead?
Publication
Risky Left Turns – What About a Roundabout?
Publication
Phthalates – Why Now and Should We Be Worried?
Publication
The Hidden Costs of Convenience – The Impact of Food Delivery Apps on Auto Accidents
Publication
Focus Groups and Shadow Juries – Telling a Persuasive Story for Trial -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Publication
Key Takeaways From Our U.S. Claims Fraud Survey
Publication
Cardiovascular Disease Deaths in Young Adults – A Tie to Substance Use?
Publication
Individual Life Accelerated Underwriting – Highlights of 2024 U.S. Survey
Publication
Ups and Downs of the U.S. Group Term Life Market U.S. Industry Events
U.S. Industry Events
Publication
New Life & Health Technologies – A Double-edged Sword? -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
PHi-Newsletter – April 2024

April 22, 2024
Deutsch
- Deutschland – Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes beschlossen
- Europa – EU‑Produkthaftungsrichtlinie im Europäischen Parlament verabschiedet
- Europa – EU‑Parlament verabschiedet KI‑Gesetz
- Europa – EU‑Lieferkettengesetz beschlossen
- Vereinigtes Königreich – Berufungsgericht zu rechtlicher Prüfung der Vorhersehbarkeit bei Mesotheliomklagen
Möchten Sie künftige Ausgaben sofort nach Erscheinen erhalten? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen elektronischen Newsletter.
reuschlaw
Produktsicherheit. Regulatory Affairs. Umweltrecht
25.‑26. April 2024, Spreespeicher, Berlin
Tauschen Sie sich mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, Konsumgüterindustrie, Marktaufsichtsbehörden und den Prüfstellen in Berlin über brandaktuelle Themen wie die neue Produktsicherheitsverordnung und die Produkthaftungsrichtlinie sowie passende Versicherungslösungen, die Batterieverordnung, die neue Ökodesignverordnung, Rückrufe und Marktmaßnahmen, EUDR und REACH, insbesondere mit Blick auf PFAS, aus. Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen unter: PCD: product compliance dialog
Die ersten fünf PHi-Newsletter-Leser, die sich anmelden, erhalten 20 % für alle Ticketkategorien: www.eventbrite.de/e/722671488877/?discount=PCD24_PHi20
(Rabatt hier bereits abgezogen.)
Deutschland – Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes beschlossen
Am 13. März 2024 hat das Kabinett eine Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes beschlossen. Dadurch wird u. a. der Zeitraum von der Einzelklage bis zum Musterverfahren beim Oberlandesgericht verkürzt und das Verfahren selbst dauerhaft etabliert.
Hintergrund der Einführung des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG) im Jahr 2005 war die Vielzahl von Einzelklagen von Anlegern im Zusammenhang mit dem dritten Börsengang der Deutschen Telekom und die dadurch verursachte Überlastung der Gerichte. Das bis zum 31. August 2024 geltende KapMuG befähigt Anleger in bestimmten kapitalmarktbezogenen Rechtsstreitigkeiten mittels eines speziellen zivilprozessualen Verfahrens, Schäden wegen falscher, irreführender oder unterlassener Angaben in Anlageinformationen in einem gebündelten Verfahren einzuklagen und dabei zügig eine obergerichtliche Klärung herbeizuführen.
Das Instanzgericht, bei dem mindestens zehn Einzelklagen mit jeweils gleichen Tatsachen- und Rechtsfragen vorliegen, legt diese dafür dem zuständigen nächsthöheren Gericht – bei Klagen vor dem Landgericht dem Oberlandesgericht – vor. Dieses wählt sodann eines der Verfahren als Musterverfahren aus. Die daraufhin getroffene Entscheidung hat Bindungswirkung für alle individuellen Klagen.
Nun wurde durch eine Verkürzung von Fristen und einer Konzentration von Zuständigkeiten die Dauer von der Einzelklage bis zum Musterverfahren verkürzt. Außerdem legt das Oberlandesgericht künftig selbst die Feststellungsziele für das Musterverfahren fest. Weiter wurde die Zahl der Verfahrensbeteiligten reduziert, indem nicht mehr automatisch alle den Gegenstand des Musterverfahrens betreffende Einzelklagen automatisch in das Musterverfahren einbezogen werden. Parteien können ihre Einzelklage künftig stattdessen als Einzelverfahren weiterführen. Außerdem sollen die Verfahrensakten des Musterverfahrensgesetzes bereits vor der für andere Gerichte geltenden Frist, dem 1. Januar 2026, digital geführt werden. Das Verfahren selbst wird dauerhaft etabliert. Der Regierungsentwurf zur Reform des KapMuG wurde am 11. April 2024 im Bundestag in erster Lesung beraten und wurde nun in den führenden Rechtsausschuss überwiesen. Ein ausführlicher Beitrag zur Reform des KapMug erscheint in Ausgabe 2/2024 von PHi.
Europa – EU‑Produkthaftungsrichtlinie im Europäischen Parlament verabschiedet
Am 12. März 2024 hat das Europäische Parlament neue EU‑Verbraucherschutzvorschriften verabschiedet, um besser auf das zunehmende Online-Shopping, neue Technologien und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft reagieren zu können. Darunter auch die neue EU‑Produkthaftungsrichtlinie (Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über die Haftung für fehlerhafte Produkte).
Die aktualisierte Richtlinie vereinfacht die Anforderungen an die Beweislast für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und hebt die Mindestschadenschwelle von EUR 500 auf. Unter den Begriff Schäden fallen künftig dabei auch immaterielle Schäden, einschließlich medizinisch anerkannter Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, sowie zerstörte oder beschädigte Daten.
Die Haftung trifft nach der neuen Richtlinie dabei immer ein zu benennendes, in der EU ansässiges Unternehmen, z. B. den Hersteller, Importeur oder seinen Bevollmächtigten, auch wenn das entsprechende Produkt online von außerhalb der EU gekauft wurde.
In Fällen, in denen die Fehlersymptome nur langsam auftreten, wird die Haftungsfrist auf 25 Jahre verlängert.
Die Richtlinie muss nun noch formell vom Rat verabschiedet werden und tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft. Die neuen Vorschriften gelten dann erstmals für Produkte, die wiederum 24 Monate danach auf den Markt gebracht werden.
Europa – EU‑Parlament verabschiedet KI‑Gesetz
Am 13. März 2024 hat das Europäische Parlament das neue EU‑Gesetz für Künstliche Intelligenz (AI Act) verabschiedet.
Mit dem Gesetz soll in Europa ein verlässliches Umfeld für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) entstehen. Die neuen Regeln zielen darauf ab, Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie ökologische Nachhaltigkeit vor Hochrisiko-KI‑Systemen zu schützen. Gleichzeitig sollen sie Innovationen ankurbeln und dafür sorgen, dass die EU in diesem Bereich eine Führungsrolle einnimmt.
Die Verordnung legt bestimmte Verpflichtungen für KI‑Systeme fest, abhängig von den jeweiligen möglichen Risiken und Auswirkungen. So sieht der AI Act nur für solche Anwendungen Auflagen vor, von denen ein Risiko für das Leben oder auch die Menschen- und Bürgerrechte ausgeht. Die Anwendungen werden dafür in verschiedene Risikoklassen eingestuft.
Gänzlich verboten sind einige KI‑Anwendungen, die die Rechte der Bürgerinnen und Bürger bedrohen, wie etwa das „Social Scoring“ – eine Bewertung des Verhaltens von Menschen, wie es bspw. in China eingesetzt wird, um Menschen zu systemkonformem Verhalten zu bewegen.
Hochriskante Anwendungen mit einem unbestreitbaren Nutzen, die aber auch irreparablen Schaden anrichten können, wie KIs, die über die Vergabe von Versicherungen oder Krediten entscheiden und den Ausgang von Wahlen beeinflussen können sowie das autonome Fahren müssen Mindeststandards erfüllen.
Die Daten, mit denen solche KIs versorgt werden, dürfen keine Entscheidungen auf Basis von Kriterien wie politischen oder religiösen Ansichten, der sexuellen Orientierung oder der Hautfarbe basieren. Es muss immer ein Mensch die letzte Kontrolle haben. Zudem muss dokumentiert werden, wie sich das selbstlernende System entwickelt und welche Schlüsse es zieht.
Für generative KI wie ChatGPT oder Midjourney, deren Basismodelle eine bestimmte Rechenleistung überschreiten, müssen die Anbieter Transparenzpflichten erfüllen, die Modelle regelmäßig überprüfen und systemische Risiken einhegen. Sie müssen schwere Zwischenfälle melden und die Modelle von Dritten testen lassen.
Die Verordnung wird nun von Rechts- und Sprachsachverständigen abschließend überprüft. Sie dürfte noch vor Ende der Wahlperiode im Rahmen des sog. Berichtigungsverfahrens angenommen werden. Auch muss der Rat die neuen Vorschriften noch förmlich annehmen. Das Gesetz wird ab dem Frühjahr 2026 gelten.
Europa – EU‑Lieferkettengesetz beschlossen
Am 19. März 2024 hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI) die politische Einigung zur Richtlinie zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD, EU‑Lieferkettenrichtlinie oder EU‑Lieferkettengesetz) angenommen.
Sie verpflichtet Unternehmen, Standards wie das Verbot von Kinderarbeit und Ausbeutung über die gesamte Lieferkette hinweg und damit auch bei allen Lieferanten einzuhalten.
Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande haben bereits nationale Sorgfaltspflichtengesetze beschlossen. Die EU hatte bereits Teilbereiche (Konfliktmineralien, Holzmarkt, Nachhaltigkeitsberichterstattung) reguliert und auch international gibt es einen klaren Trend zur Verrechtlichung von Unternehmensverantwortung.
Erfasst von der neuen Lieferkettenrichtlinie sind – nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren – Unternehmen bereits ab 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von EUR 450 Mio. pro Jahr. Nach drei Jahren sollen die Vorgaben zunächst für Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und mehr als EUR 1,5 Mrd. Umsatz weltweit gelten. Ein Jahr später dann ab 4.000 Mitarbeiter und EUR 900 Mio.
Neu dazu kommt die Haftung: Unternehmen sollen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es sie ihren Sorgfaltspflichten nicht nachkommen.
Im nächsten Schritt muss noch das Plenum des Europäischen Parlaments zustimmen und der Europäische Rat das Ergebnis formell bestätigen. Zudem müssen die bereits bestehenden nationalen Gesetze an die Lieferkettenrichtlinie angepasst werden.
Vereinigtes Königreich – Berufungsgericht zu rechtlicher Prüfung der Vorhersehbarkeit bei Mesotheliomklagen
Der Court of Appeal hat in seinem Urteil vom 14. März 2024 wichtige Hinweise zu den rechtlichen Kriterien für die Haftung bei asbestbedingten Mesotheliomklagen gegeben, durch die die Durchsetzung von Ansprüchen in vielen dieser Fälle erschwert werden wird.
Verhandelt wurden die Berufungen in den Rechtssachen White vs. Secretary of State for Health and Social Care und Cuthbert vs. Taylor Woodrow Construction Holdings. In diesen waren zwei mittlerweile verstorbene Arbeitnehmer bis 1959 bzw. 1960 einer leichten bzw. intermittierenden Asbestexposition ausgesetzt. In den Jahren 2019/2021 erkrankten sie jeweils an einem Mesotheliom, an dem beide später starben.
In beiden Fällen entschied das Gericht nun, dass das Risiko einer Schädigung der beiden Männer zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht vorhersehbar war und daher die Beklagten nicht haften. Es bestätigte damit in beiden Fällen die Urteile der ersten Instanz.
Anders als in Bezug auf die bekannte fibrotische Lungenerkrankung Asbestose wurde der Kausalzusammenhang zwischen Asbest und Mesotheliom erst Anfang der 1960er-Jahre nachgewiesen, d. h. nachdem die Exposition der beiden Kläger bereits beendet war.
Auch wenn das Mesotheliomrisiko damit zum betreffenden Zeitpunkt nicht vorhersehbar sein konnte, ließ das Gericht es zunächst grundsätzlich ausreichen, dass durch die Asbestexposition jedenfalls ein Gesundheitsschaden allgemeiner Art vorhersehbar war.
Die Fälle scheiterten jedoch am gleichwohl verlangten Nachweis, dass die Asbestmengen, denen die beiden Kläger ausgesetzt waren, ein generell vorhersehbares Risiko darstellten. So stellte das Gericht fest, dass allein das Ausmaß und nicht nur die Art der Exposition den Kern der vernünftigen Vorhersehbarkeit bildet. Diese hatte das Gericht erst ab einer für eine Asbestose ausreichenden Konzentration angenommen, da allein in diesem Zusammenhang überhaupt irgendeine Art Gesundheitsschaden vorhersehbar gewesen wäre. Das Berufungsgericht wies die Berufung einstimmig zurück und stellte fest, dass nach den damaligen Maßstäben keiner der beiden Beklagten hätte wissen müssen, dass die beanstandete Exposition ein erhebliches Verletzungsrisiko mit sich bringen würde.
Rechtlicher Hinweis
Alle hier enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch wird für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernommen. Insbesondere stellen diese Information keine Rechtsberatung dar und können eine solche auch nicht ersetzen.