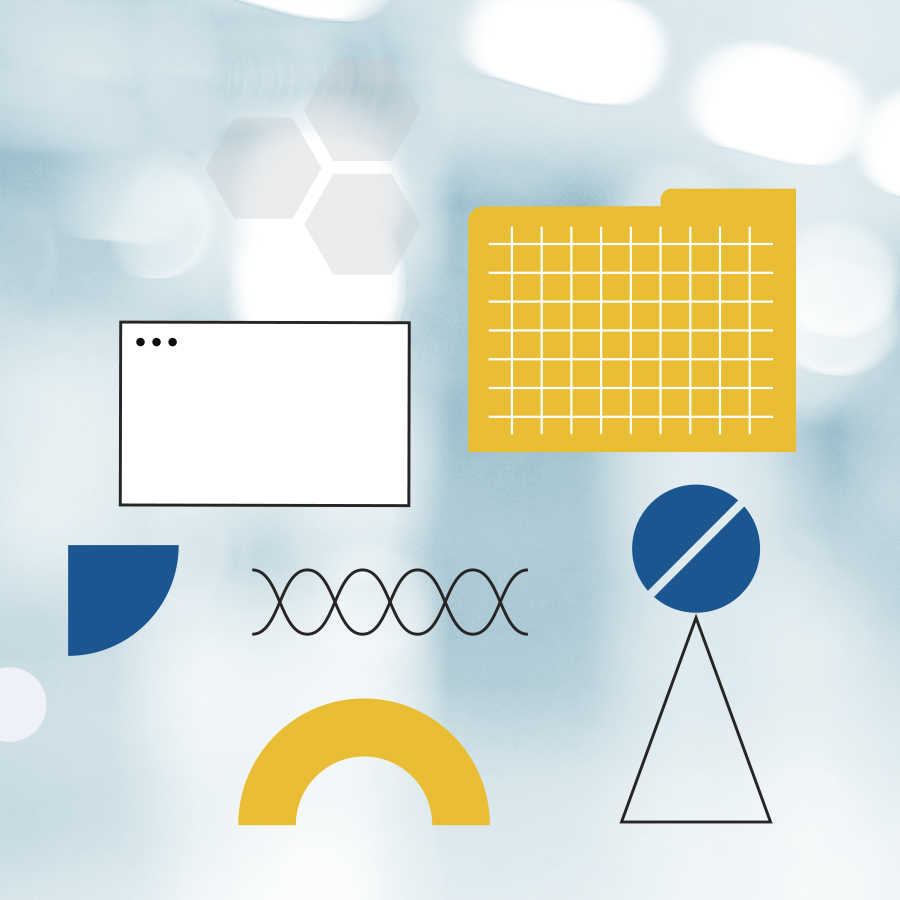-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Trending Topics
Publication
Production of Lithium-Ion Batteries
Publication
PFAS – Rougher Waters Ahead?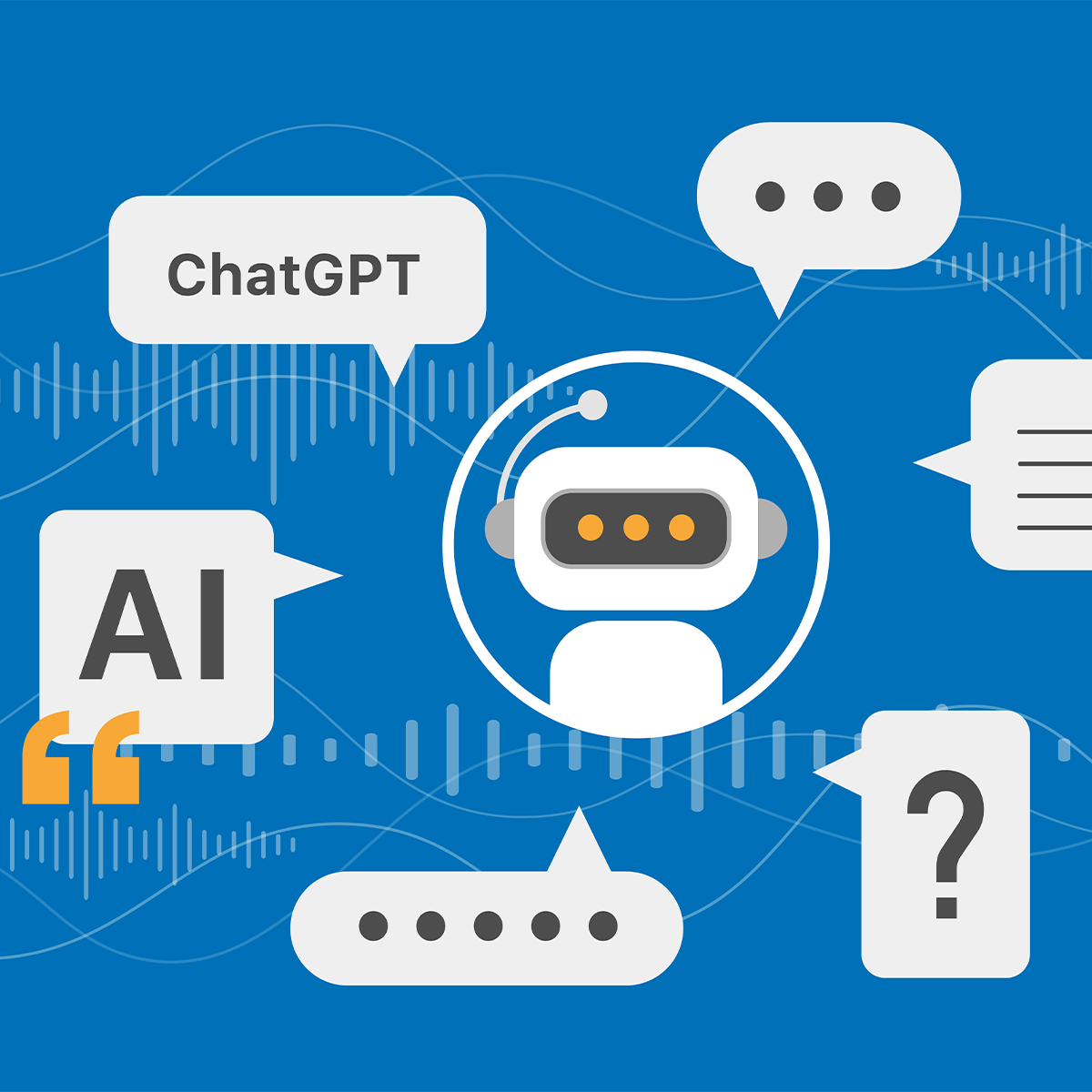
Publication
Generative Artificial Intelligence in Insurance – Three Lessons for Transformation from Past Arrivals of General-Purpose Technologies
Publication
Did you Know? A Brief Reflection on La Niña and El Niño
Publication
Time to Limit the Risk of Cyber War in Property (Re)insurance
Publication
Pedestrian Fatalities Are on the Rise. How Do We Fix That? -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Training & Education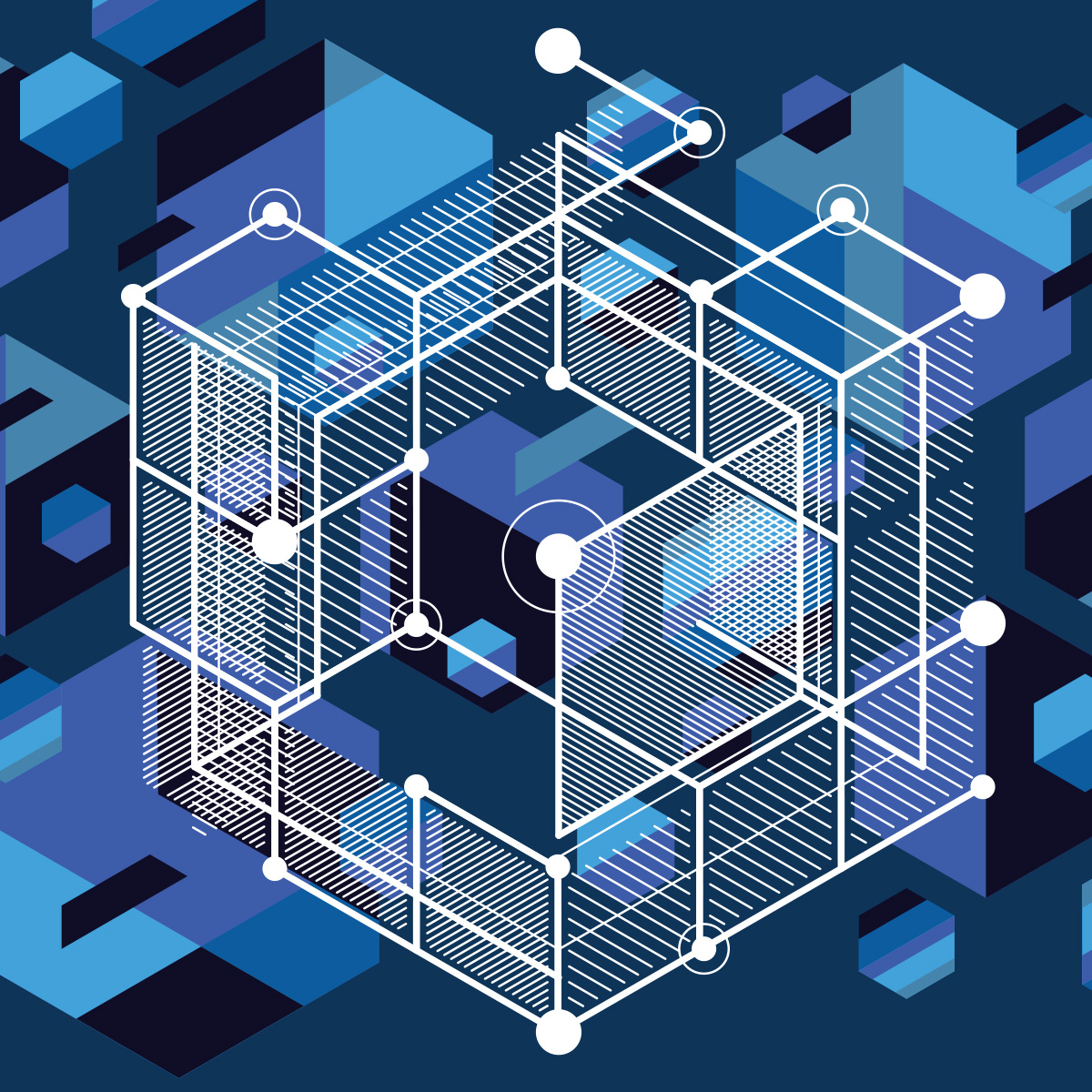
Publication
When Actuaries Meet Claims Managers – Data-Driven Disability Claims Review
Publication
Chronic Pain and the Role of Insurers – A Multifactorial Perspective on Causes, Therapies and Prognosis
Publication
Fasting – A Tradition Across Civilizations
Publication
Alzheimer’s Disease Overview – Detection and New Treatments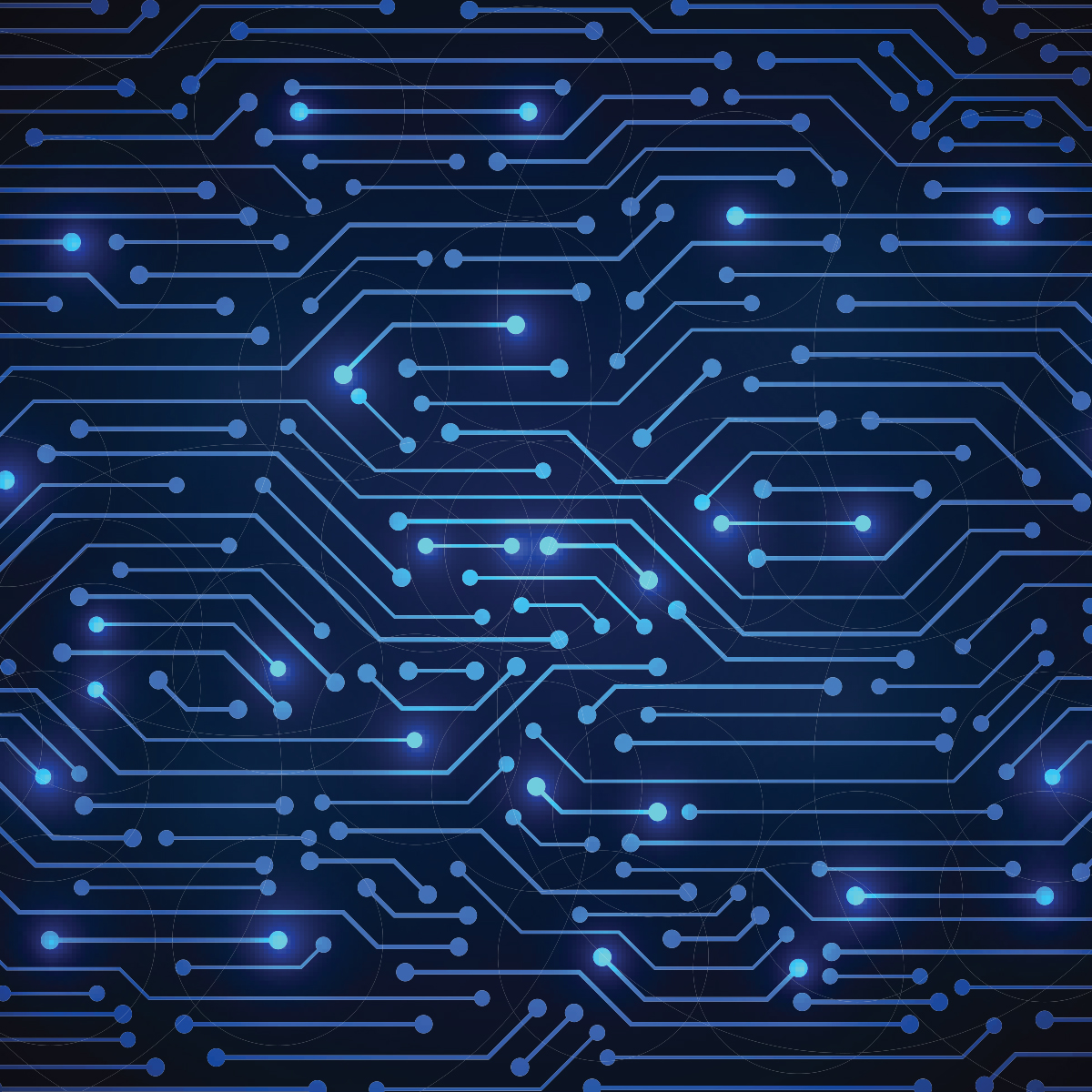
Publication
Simplicity, Interpretability, and Effective Variable Selection with LASSO Regression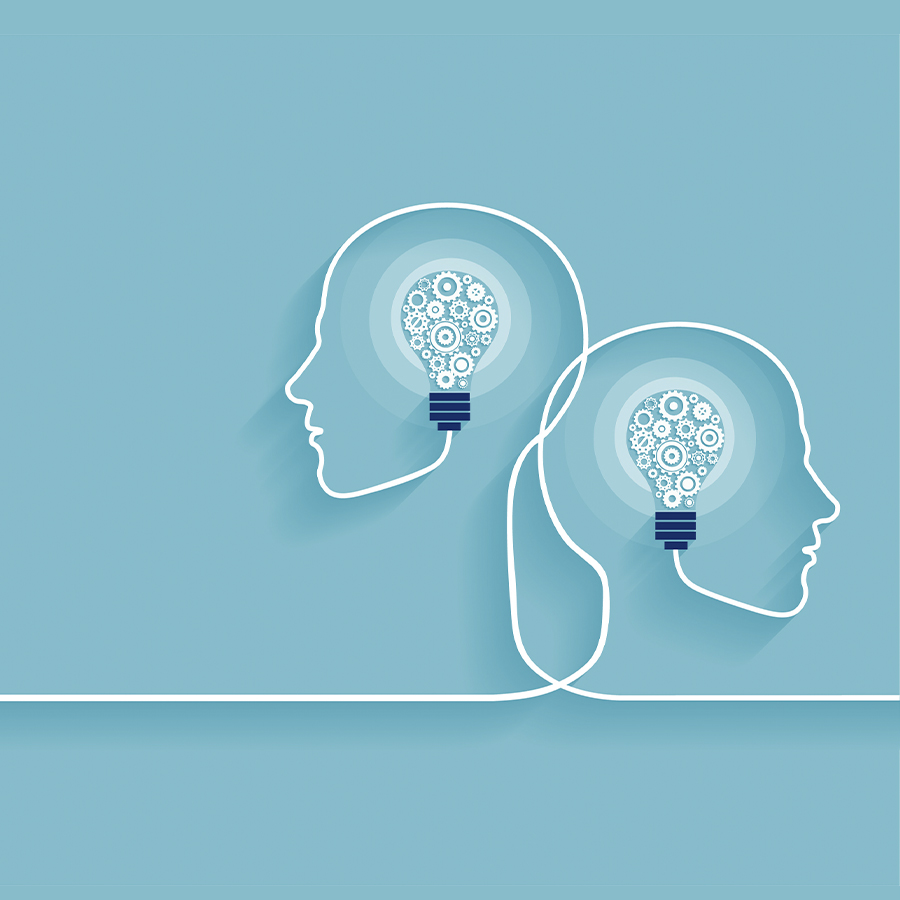 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
Die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper – unsichtbarer Störfaktor oder kalkulierbares Risiko?

June 26, 2024
Annika Luckmann
Deutsch
English
Welche Beziehung besteht zwischen Geist und Körper? Einer der ersten Philosophen, der sich mit dieser komplexen Frage beschäftigte, war René Descartes (der vielen auch als Mathematiker mit seinen Arbeiten u. a. zur Geometrie bekannt sein dürfte). Im 16. Jahrhundert entwickelte er das Konzept des Dualismus: die Überzeugung, dass Geist und Körper aus zwei verschiedenen Substanzen bestehen.
Der Geist hat keine physische Existenz und nimmt daher auch keinen Raum ein. Der Körper hingegen nimmt Raum ein. Descartes war sich sicher, dass es im Gehirn einen Ort geben muss, an dem die materiellen und immateriellen Substanzen miteinander kommunizieren. Er war überzeugt, dass die Zirbeldrüse „der Hauptsitz der Seele“ sei und der Ort, an dem alle unsere Gedanken entstehen.1
Heute wissen wir, dass die Zirbeldrüse eine endokrine Drüse ist, die für die Melatoninproduktion in Abhängigkeit vom Hell-Dunkel-Zyklus verantwortlich ist und damit eine wichtige Schlüsselrolle im zirkadianen System, unserer inneren Uhr, spielt. Doch was versteht man heute unter der Verbindung zwischen Geist und Körper und wo befindet sich der Geist?
Ich habe diese Frage der künstlichen Intelligenz (KI) der Microsoft-Suchmaschine Bing gestellt und folgende Antwort erhalten: Der Geist ist „eine Fähigkeit, die sich in mentalen Phänomenen wie Empfindung, Wahrnehmung, Denken, Argumentation, Gedächtnis, Glauben, Wunsch, Emotion und Motivation manifestiert. Die genaue Natur und der genaue Ort sind unbekannt und werden diskutiert.“2 Doch auch damit ist das Geist-Körper-Problem nicht gelöst. Zu den modernen Ansätzen, die die Verbindung von Geist und Körper erklären, gehören der Physikalismus, der Funktionalismus, die verkörperte Kognition und das Konzept des erweiterten Geistes.
Physikalismus und Funktionalismus
Der Geist ist mit dem Gehirn identisch oder auf dieses reduzierbar und befindet sich im Gehirn oder ist über verschiedene Gehirnregionen verteilt. Ein von den Verfechtern des Physikalismus häufig angeführtes Beispiel ist der mentale Zustand des Schmerzes, der mit der Aktivität der C‑Fasern im Gehirn identisch ist. Der Funktionalismus geht davon aus, dass jede Entität mit einem Gehirn auch einen Geist besitzt.
Den Menschen zu sagen, dass ihre komplexen Emotionen wie Freude oder Trauer, aber auch ihr Selbstgefühl und ihre persönliche Identität und sogar das Konzept des freien Willens nichts anderes sind als der Zustand von Ansammlungen von Nervenzellen und Molekülen, ist keine Antwort auf das Geist-Körper-Problem, die die meisten Menschen akzeptieren können. Wie Francis Crick 1994 sagte: „Du bist nichts weiter als eine Ansammlung von Neuronen.“3
Verkörperte Kognition und erweiterter Geist
Der Geist ist nicht im Gehirn eingeschlossen, sondern geht weit darüber hinaus und ist im Körper und seiner Interaktion mit der Umwelt und unseren sozialen Interaktionen angesiedelt. Anhänger dieser Theorien sehen das Gehirn nicht als alleinigen Sitz der Kognition und betonen, dass die Informationsverarbeitung im Gehirn nicht mit der eines Computers gleichzusetzen ist.
Das Thema der Verbindung von Geist und Körper wird von Philosophen und Neurowissenschaftlern nach wie vor intensiv untersucht. In neuen Veröffentlichungen finden sich immer mehr Beweise für eine Verbindung von Geist und Körper, die in den Gehirnprozessen sichtbar wird. Eine neuere Studie legt nahe, dass Areale im motorischen Kortex eine wichtige Rolle bei der Integration von Planung und Absicht (also Prozessen, die mit dem Geist in Verbindung gebracht werden) und Physiologie, Verhalten und Bewegung (Prozessen, die mit dem Körper in Verbindung gebracht werden) spielen.4
Beispiele für die Verbindung zwischen Geist und Körper
Zahlreiche Beispiele illustrieren die enge Verbindung zwischen unserem Geist und unserem Körper. Die Epigenetik ist eines davon und veranschaulicht, wie das Immaterielle das Materielle beeinflussen kann. Die Epigenetik beschreibt, wie Umweltfaktoren die Ausprägung von Genen verändern können, ohne die DNA‑Sequenz zu verändern. (Wenn Sie sich für das Thema Epigenetik interessieren, lesen Sie diesen Artikel meiner Kollegen mit dem Titel „Epigenetische Tests – ein zukünftiges Thema in der Risikoprüfung?“).
Eine Studie ergab, dass Kinder, die missbraucht oder vernachlässigt wurden, veränderte Muster der Genexpression aufweisen. Diese Veränderung führte zu einem erhöhten Risiko, langfristig psychische und körperliche Störungen zu entwickeln.5 Die Forschung hat sogar die Vorstellung einer transgenerationalen, stressinduzierten Epigenetik unterstützt,6 was bedeutet, dass die Stressfaktoren, die die Großeltern einer Person durchgemacht haben, ihre Anfälligkeit für bestimmte psychische und körperliche Störungen und ihre Widerstandsfähigkeit beeinflussen können.7
Ein vertrauteres Beispiel ist, wie sich Stress auf den Körper auswirkt. Es wurde festgestellt, dass sich entzündliche Hauterkrankungen wie Akne, Psoriasis und Rosazea durch chronischen Stress verschlimmern. Aber auch wenn keine entzündliche Erkrankung vorliegt, beeinflusst Stress unseren Körper auf verschiedene Weise. Es ist von Vorteil, dass der Körper auf Stress mit einer Immunreaktion reagiert und sich darauf vorbereitet, potenzielle Krankheitserreger zu bekämpfen. Wenn man jedoch langanhaltendem Stress ausgesetzt ist, wird diese Immunreaktion chronisch ausgelöst, und das Risiko, chronische Krankheiten zu entwickeln, steigt erheblich.
Der Hauptakteur bei diesem Effekt ist Cortisol. Im menschlichen Körper existiert ein sehr elegantes System, das darauf abzielt, einen Zustand der Homöostase zu erreichen, wenn es um Stresshormone geht, die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA‑Achse). Bleibt der Cortisolspiegel hoch, versagt dieses System schließlich und führt zu einem Ungleichgewicht, da der Cortisolstoffwechsel verringert wird und der Cortisolspiegel hoch bleibt. Diese Dysregulation der HPA‑Achse kann nachweislich das Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionen erhöhen.8
Was kann der Einzelne tun, um die Verbindung zwischen Geist und Körper positiv zu nutzen? Nicht alle anhaltenden Stresssituationen lassen sich vermeiden, aber es gibt Möglichkeiten, den Körper vor den langfristigen Folgen von Stress zu bewahren oder teilweise zu schützen. Eine Möglichkeit, die sich als vorteilhaft erwiesen hat, ist die Meditation, die als Vermittler zwischen Körper und Geist wirken kann.9 Sie verringert den Stress und verbessert so die allgemeine geistige Gesundheit. Positive Emotionen haben sich ebenfalls als eine Art Schutzschild erwiesen.
Im Bereich der Psychoneuroimmunologie wird untersucht, wie das Nervensystem, das endokrine System und unser Immunsystem zusammenwirken. Studien legen nahe, dass positive Emotionen das Immunsystem stärken. So erkrankten beispielsweise Teilnehmer, die über ein höheres Maß an Stress und negativen Emotionen berichteten, als sie einem Erkältungsvirus ausgesetzt waren, mit größerer Wahrscheinlichkeit an dem Erkältungsvirus, verglichen mit Probanden, die über weniger Stress und einen positiveren emotionalen Zustand berichteten.10
Natürlich lassen sich emotionale Zustände nicht immer in eine positive Richtung lenken, und Stress ist ein Teil des Lebens. Diese Studien verdeutlichen jedoch, wie wichtig es ist, in stressigen Lebensabschnitten Wege zur Regeneration zu finden und freudige Momente zu erleben. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, das System zu überlisten: Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Lächeln das Gehirn dazu bringen kann, mehr positive Gefühle zu empfinden.11
Ein weiteres gut erforschtes Phänomen, das die Verbindung zwischen Körper und Geist unterstreicht, ist die Darm-Hirn-Achse. Wir alle kennen den Ausdruck „Bauchgefühl“, und nicht umsonst wird der Darm manchmal als „zweites Gehirn“ bezeichnet. Die Gesundheit des Darms spielt eine wichtige Rolle bei der Anpassung an Stress, und es hat sich gezeigt, dass ein anhaltend hoher Cortisolspiegel die Durchlässigkeit des Darms bei Tieren12 und Menschen erhöht.13
Verschiedene Studien zeigen, dass Ungleichgewichte in der Darmmikrobiota mit spezifischen Stimmungs- und Angststörungen korrelieren können,14 was nicht bedeutet, dass eine schlechte Darmgesundheit Depressionen bei einer Person verursacht, die ansonsten nicht betroffen wäre, sondern dass die Darmgesundheit bei Menschen, die mit klinischen Depressionen zu kämpfen haben, Unterschiede zu Menschen aufweist, die keine klinische Depression haben. Es wurde festgestellt, dass das Mikrobiom von depressiven Patienten eine geringere bakterielle Vielfalt aufweist, was ihre allgemeine Fähigkeit, auf Stress zu reagieren, beeinträchtigt.15
Die Überrepräsentation bestimmter Bakterienarten wurde außerdem mit entzündlichen Prozessen in Verbindung gebracht.16 Weiterhin ergab sich in einer Studienpopulation mit Depressionen, dass die Konversion von Tryptophan zu Serotonin, einem zentralen Neurotransmitter, reduziert ist.17 Es wurde auch über Zusammenhänge mit klinischen Episoden von bipolarer Störung und Schizophrenie berichtet.18
Psychiatrische Diagnosen und ihre Auswirkungen auf den Körper
Personen mit diagnostizierten psychiatrischen Erkrankungen zeigen eine erhöhte Gesamtmortalität und Morbidität. Auch wenn Selbstmord für die meisten Menschen der Auslöser ist, der ihnen in den Sinn kommt, wenn es um die erhöhte Sterblichkeit bei Antragstellern mit einer psychischen Vorgeschichte geht, ist dies nur ein kleiner Teil des Grundes dafür, dass Lebensversicherungsprodukte für diese Gruppe von Antragstellern mit einer höheren Prämie verbunden sind.
Betrachtet man Störungen, die mit schwerem Stress oder traumatischen Ereignissen zusammenhängen, wie z. B. posttraumatische Belastungsstörungen, akute Belastungsstörungen oder Anpassungsstörungen, so stellt man fest, dass die Gesamtmortalität bei diesen Diagnosen nachweislich erhöht ist.19 Eine 2022 veröffentlichte Studie aus Schweden,20 die das nationale Patientenregister als Probandenpool nutzte, wollte herausfinden, ob die Gesamtmortalität in dieser Studienpopulation durch genetische Faktoren beeinflusst wurde oder ob die Diagnose selbst dabei eine wichtige Rolle spielte.
Die Probanden wurden in drei Hauptgruppen eingeteilt. Gruppe 1 war die „exponierte Gruppe“, d. h. diejenigen, bei denen eine stressbedingte Störung diagnostiziert wurde (mit zwei Untergruppen, von denen eine mit Gruppe 2 und eine mit Gruppe 3 verglichen wurde); Gruppe 2 war eine geschlechtsgleiche Kontrollgruppe; Gruppe 3 waren Geschwister der exponierten Teilnehmer, die selbst nicht exponiert waren.
Die Teilnehmer der exponierten Gruppe waren eher geschieden oder verwitwet, hatten ein niedrigeres Familieneinkommen, eine höhere Belastung durch somatische Krankheiten und hatten eher eine Vorgeschichte mit anderen psychiatrischen Störungen. Die Gesamtmortalität erreichte ihren Höhepunkt im ersten Jahr nach der Diagnose (3‑faches Risiko, HR 3,19 [95 % CI, 2,87–3,54]), blieb aber im Vergleich zur Kontrollgruppe auch danach signifikant erhöht (1,6‑faches Risiko, HR 1,64 [95 % CI, 1,60–1,67]).
Suizid spielte eine große Rolle bei der höheren Gesamtmortalität, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren von Bedeutung. Den Autoren zufolge hätten 70 % der in ihrer Studienpopulation beobachteten Todesfälle potenziell vermieden werden können, z. B. durch eine angemessene Behandlung. Es wurde festgestellt, dass die erhöhte Sterblichkeit weitgehend unabhängig von der genetischen Komponente ist, die sie durch Einbeziehung der Geschwister getestet haben. Als mögliche Gründe für die erhöhte Sterblichkeit werden die bei mehr als einem Drittel der exponierten Gruppe festgestellten komorbiden psychiatrischen Erkrankungen, chronischer psychischer Stress, der zu einem dysregulierten Immunsystem und möglicherweise zu Entzündungen führt, sowie ungesunde Bewältigungsmechanismen und Verhaltensweisen wie Rauchen, schlechte Ernährung und Bewegungsmangel diskutiert, die dann zu einem höheren Auftreten (mehrerer) schwerer chronischer Krankheiten in dieser Probandengruppe beitragen könnten.
Angstzustände und Depressionen sind Diagnosen, die bei der Risikoprüfung relativ häufig in Anträgen auftauchen. Wie wirken sich diese Diagnosen auf den allgemeinen Gesundheitszustand einer Person aus? Im Jahr 2007 untersuchte eine Forschergruppe den Zusammenhang zwischen chronischen körperlichen Erkrankungen und Depressionen und/oder Angstzuständen.21 Insgesamt wurde eine höhere Inzidenz von Bluthochdruck, Arthritis, Herzerkrankungen, chronischen Kopfschmerzen und multiplen Schmerzsyndromen festgestellt. Als jemand mit einem multiplen Schmerzsyndrom galt in dieser Studie jeder Proband, der zwei oder mehr der folgenden Erkrankungen hat: Arthritis, chronische Rückenschmerzen, chronische Nackenschmerzen, chronische Kopfschmerzen oder andere Arten chronischen Schmerzens. Bei Personen mit einer nicht komorbiden Depression (d. h. ohne Angstzustände) lag das Odds Ratio für Herzerkrankungen bei 2,0; bei Personen mit Angstzuständen (ohne komorbide Depression) bei 1,9 und bei Personen mit beiden Diagnosen stieg es auf 3,0.
Bei Probanden, die in die Kategorie des multiplen Schmerzsyndroms fallen, ist die Zahl derer, die sowohl an Depressionen als auch an Angstzuständen leiden, um das 4,5‑Fache höher als bei Personen, die an keiner der beiden psychischen Diagnosen leiden. Bei der risikoprüferischen Beurteilung von z. B. Berufsunfähigkeitsprodukten oder Grundfähigkeiten sollten wir uns daher dieser Beziehung zwischen Körper und Geist bewusst sein.
Auswirkungen auf die Risikoprüfung
In der Risikoprüfung ist es entscheidend, die Berichte eines Antragstellers über Episoden schlechter psychischer Gesundheit oder psychiatrische Vorerkrankungen zu berücksichtigen, dass die psychische Gesundheit direkt mit dem allgemeinen Gesundheitszustand zusammenhängt und somit die Mortalität und Morbidität des Antragstellers beeinflusst.
Studien haben gezeigt, dass die Verbindung zwischen Geist und Körper den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden eines Menschen auf verschiedene Weise beeinflussen kann. Es ist wichtig zu bedenken, dass „körperliche“ Störungen nicht getrennt von psychischen Erkrankungen und psychiatrischen Diagnosen betrachtet werden sollten. Wenn jemand über psychische Probleme berichtet, ist das Risiko, dass er eine chronische, scheinbar nicht damit zusammenhängende Erkrankung, z. B. eine kardiovaskuläre oder Arthritis entwickelt, deutlich erhöht, was sich langfristig auf sein Invaliditätsrisiko auswirkt, selbst wenn die körperliche Erkrankung bei der Vertragsunterzeichnung nicht erkennbar war.
- Descartes, R. (2009). The passions of the soul (1649). In B.F. Gentile & B.O. Miller, Foundations of psychological thought: A history of psychology (pp.5‑21). Sage Publications, Inc.
- Bing AI. Personal communication, 19 November 2023
- Crick, F.H.C. (1994). The astonishing hypothesis: The scientific search for the soul. Charles Scribner’s Sons
- Gordon, E.M., et al. A somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex. Nature. 19 April 2023. DOI: 10.1038/s41586‑023‑05964‑2
- Yang, B.Z., et al. Child Abuse and Epigenetic Mechanisms of Disease Risk. American Journal Of Preventive Medicine 2013, 44: 101‑107
- Bale, T.L. Lifetime stress experience: transgenerational epigenetics and germ cell programming. Dialogues Clin Neurosci. 2014;16:297‑305
- Youssef, N.A. Potential Societal and Cultural Implications of Transgenerational Epigenetic Methylation of Trauma and PTSD: Pathology or Resilience? Yale J Biol Med. 2022 Mar 31;95(1):171‑174. PMID: 35370497; PMCID: PMC8961703
- Russell, G., Lightman, S. The human stress response. Nat Rev Endocrinol 15, 525‑534 (2019). https://doi.org/10.1038/s41574‑019‑0228‑0
- Creswell, J., et al. Mindfulness Training and Physical Health: Mechanisms and Outcomes. Psychosomatic Medicine 81(3):224‑232, April 2019
- Cohen S., et al. Emotional style and susceptibility to the common cold. Psychosom Med. 2003 Jul–Aug;65(4):652‑7. doi: 10.1097/01.psy.0000077508.57784.da. PMID: 12883117
- Marmolejo-Ramos, F., et al. (2020, February 4). Your face and moves seem happier when I smile. Facial action influences the perception of emotional faces and biological motion stimuli
- Zheng, G., et al. Corticosterone mediates stress-related increased intestinal permeability in a region-specific manner. Neurogastroenterol. Motil 2013;25:e127‑e139
- Dunlop S.P., et al. Abnormal intestinal permeability in subgroups of diarrhea-predominant irritable bowel syndromes. Am J Gastroenterol 2006;101:1288‑94
- Kumar A., et al. Gut Microbiota in Anxiety and Depression: Unveiling the Relationships and Management Options. Pharmaceuticals (Basel). 2023 Apr 9;16(4):565. doi: 10.3390/ph16040565. PMID: 37111321; PMCID: PMC10146621
- Madison, A., Kiecolt-Glaser, J.K. Stress, depression, diet, and the gut microbiota: human–bacteria interactions at the core of psychoneuroimmunology and nutrition. Current Opinion in Behavioral Sciences 2019;28:105‑110
- Khorsand, B., et al. Overrepresentation of Enterobacteriaceae and Escherichia coli is the major gut microbiome signature in Crohn’s disease and ulcerative colitis; a comprehensive metagenomic analysis of IBDMDB datasets. Front Cell Infect Microbiol. 2022 Oct 4;12:1015890. doi: 10.3389/fcimb.2022.1015890. PMID: 36268225; PMCID: PMC9577114
- Gao, K., et al. Tryptophan Metabolism: A Link Between the Gut Microbiota and Brain. Advances in Nutrition. 2020. 11:3:709‑723
- Bransfield, R.C., et al. Microbes and Mental Illness: Past, Present, and Future. Healthcare (Basel). 2023 Dec 29;12(1):83. doi: 10.3390/healthcare12010083. PMID: 38200989; PMCID: PMC10779437
- Lee, H., Singh G.K. Psychological distress, life expectancy, and all-cause mortality in the United States: results from the 1997‑2014 NHIS-NDI record linkage study. Ann Epidemiol. 2021 Apr;56:9–17. doi: 10.1016/j.annepidem.2021.01.002. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33453384
- Tian, F., et al. Association of stress-related disorders with subsequent risk of all-cause and cause-specific mortality: A population-based and sibling-controlled cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2022 May 28;18:100402. doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100402. PMID: 35663363; PMCID: PMC9160321
- Scott, K.M., et al. Depression-anxiety relationships with chronic physical conditions: results from the World Mental Health Surveys. J Affect Disord. 2007 Nov;103(1–3):113‑20. doi: 10.1016/j.jad.2007.01.015. Epub 2007 Feb 9. PMID: 17292480