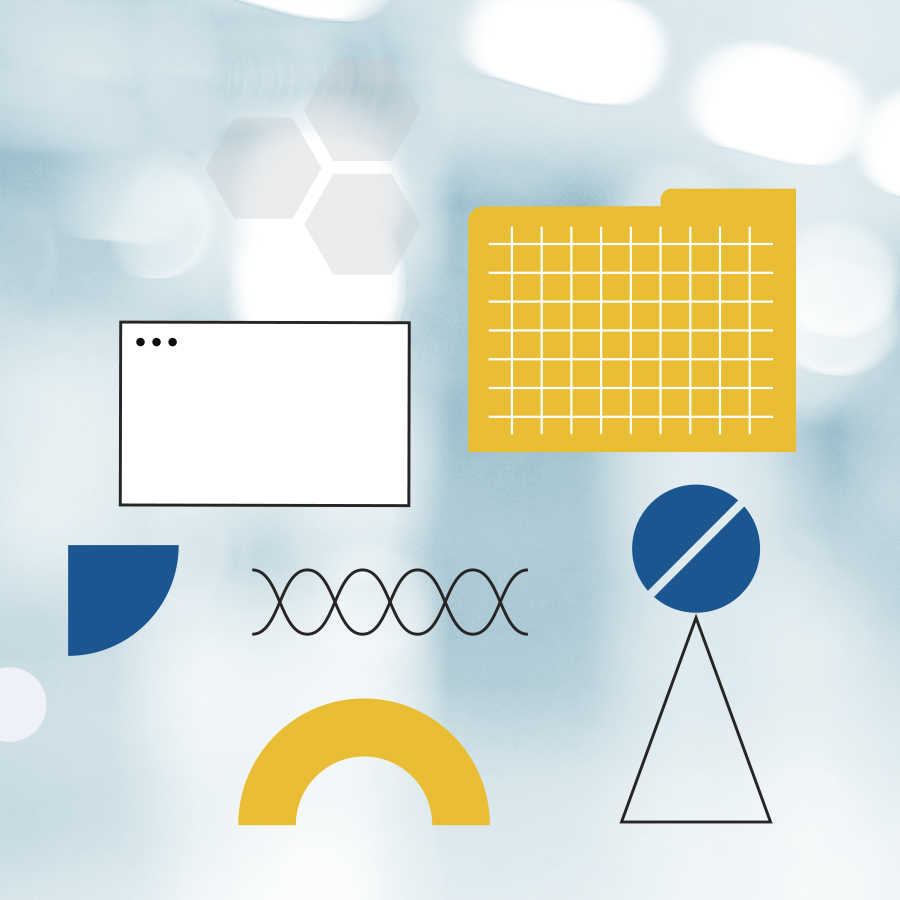-
Property & Casualty
Property & Casualty Overview

Property & Casualty
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Trending Topics
Publication
Production of Lithium-Ion Batteries
Publication
Time to Limit the Risk of Cyber War in Property (Re)insurance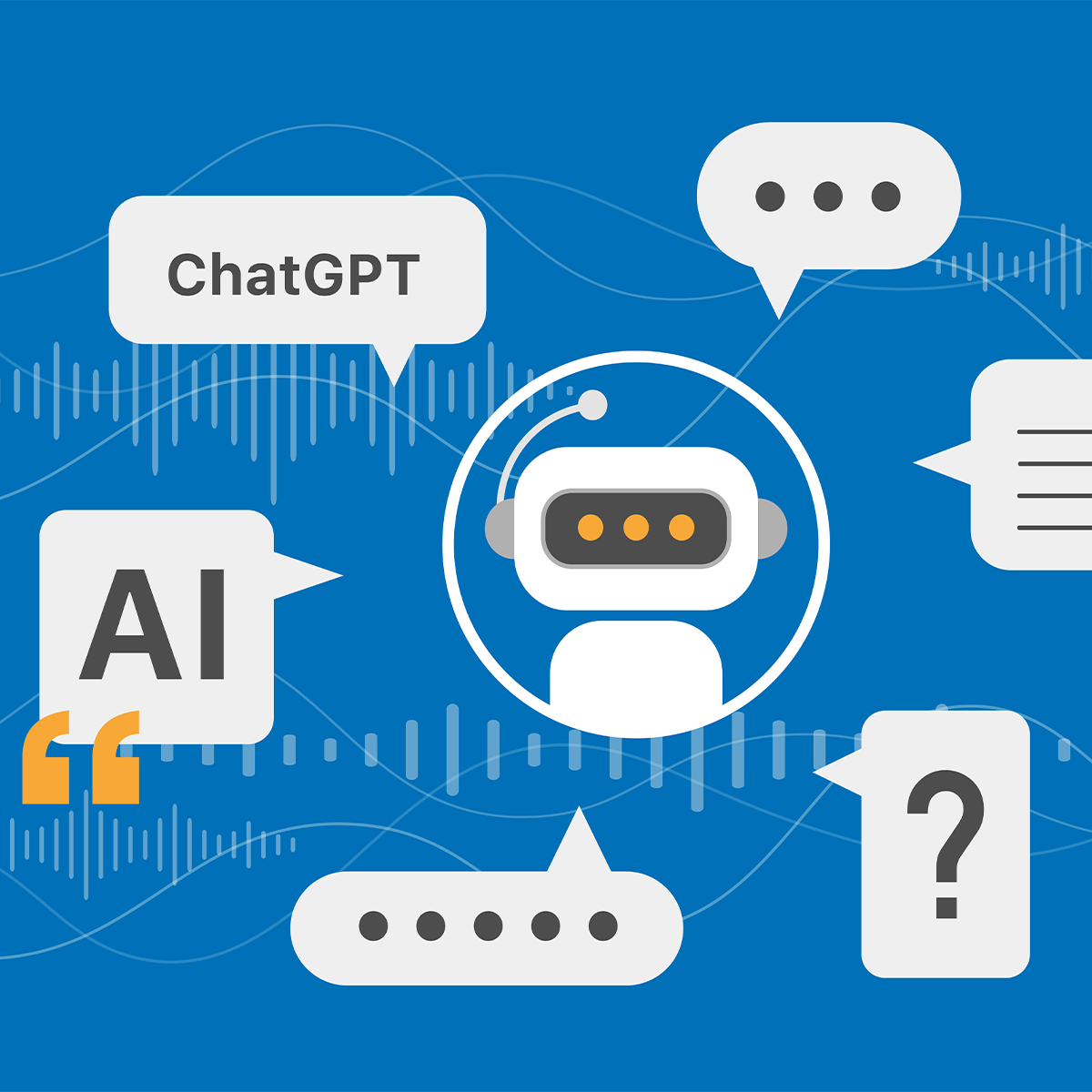
Publication
Generative Artificial Intelligence in Insurance – Three Lessons for Transformation from Past Arrivals of General-Purpose Technologies
Publication
Human Activity Generates Carbon and Warms the Atmosphere. Is Human Ingenuity Part of the Solution?
Publication
Inflation – What’s Next for the Insurance Industry and the Policyholders it Serves?
Publication
Pedestrian Fatalities Are on the Rise. How Do We Fix That? -
Life & Health
Life & Health Overview

Life & Health
We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.
Training & Education
Publication
Key Takeaways From Our U.S. Claims Fraud Survey
Publication
The Effects of Heatwaves – A Look at Heat-related Mortality in Europe and South Korea
Publication
The Key Elements of Critical Illness Definitions for Mental Health Disorders
Publication
An Overview of Mitral Regurgitation Heart Valve Disorder – and Underwriting Considerations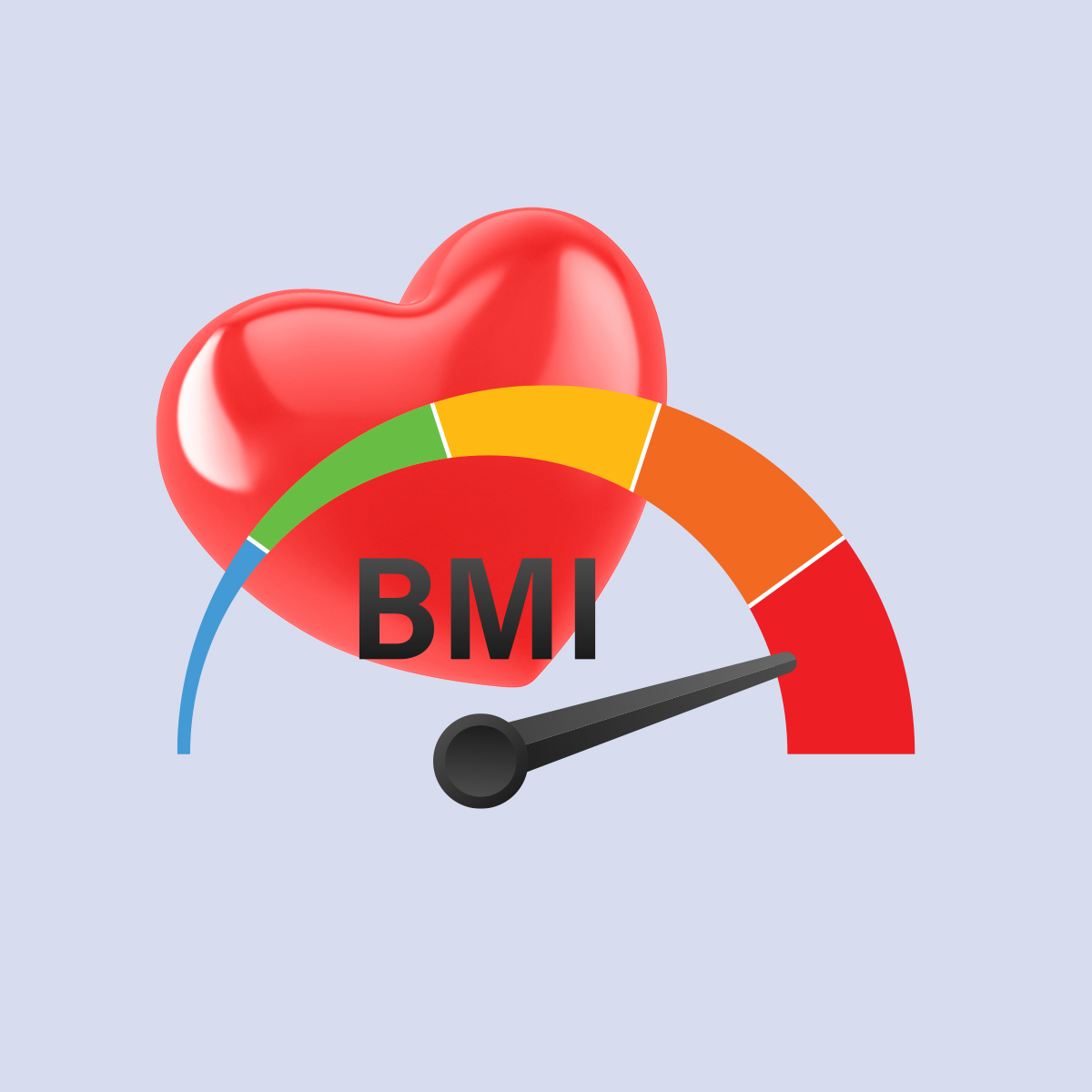
Publication
Body Mass Index as a Predictor of Cardiovascular Health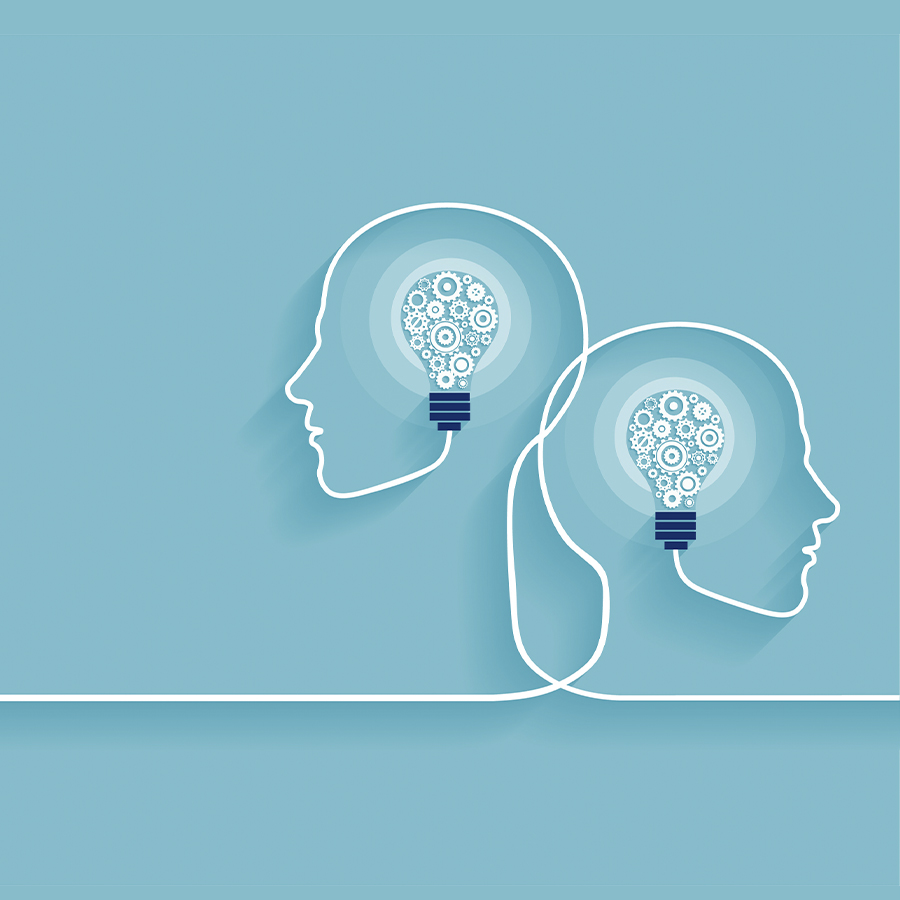 Moving The Dial On Mental Health
Moving The Dial On Mental Health -
Knowledge Center
Knowledge Center Overview

Knowledge Center
Our global experts share their insights on insurance industry topics.
Trending Topics -
About Us
About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re
Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.
- Careers Careers
PHi-Newsletter 2016

December 30, 2016
Deutsch
- Ausgabe von November 2016
- Ausgabe von September 2016
- Ausgabe von Mai 2016
- Ausgabe von März 2016
- Ausgabe von Januar 2016
Möchten Sie künftige Ausgaben sofort nach Erscheinen erhalten? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen elektronischen Newsletter.
Ausgabe von November 2016
Deutschland – Schadensersatzklagen von VW-Anlegern in Höhe von EUR 8,2 Mrd. beim Landgericht Braunschweig, Musterverfahren beim Oberlandesgericht
Bis zum 19. September 2016 sind beim LG Braunschweig insgesamt 1.400 Schadensersatzklagen von Anlegern gegen die Volkswagen AG (VW AG) wegen des Abgasskandals (Manipulationen bei der Software von Dieselmotoren) mit einem Streitwert von insgesamt ca. EUR 8,2 Mrd. eingereicht worden. Das Landgericht hat bereits am 5. August 2016 einen Vorlagebeschluss für ein Musterverfahren beim OLG Braunschweig erlassen (5 OH 62/16).
Nachdem die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) am 18. September 2015 bekannt gegeben hatte, dass die Beklagte gegen den Clean Air Act verstoßen hat, veröffentlichte die VW AG am 22. September 2015 eine entsprechende Ad-hoc-Mitteilung. Im Zeitraum 17. - 30. September 2015 brach der Kurs ihrer Stamm- und Vorzugsaktien stark ein.
Bei den Klagen handelt es sich um mehrere gebündelte Klagen von institutionellen Anlegern mit Streitwerten von EUR 30 Mio. bis EUR 2 Mrd., Klagen des Bayerischen Pensionsfonds (Streitwert EUR 700.000), des Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg (EUR 1,1 Mio.), des Sondervermögens Rücklagen des Landes Hessen (EUR 4 Mio.), der Vereinigten Staaten von Amerika (EUR 30 Mio.) und einer Vielzahl von privaten Anlegern und Gesellschaften.
In seinem Beschluss 5. August 2016 hat das Landgericht dem Oberlandesgericht zahlreiche Feststellungsziele zum Zweck eines Musterentscheids nach § 6 Abs. 1 Satz 1 KapMuG vorgelegt. Hierbei geht es im Wesentlichen darum,
- ob und ab wann der VW AG bestimmte Umstände in Bezug auf den Abgasskandal bekannt waren,
- ob es sich bei diesen Umständen um Insiderinformationen i. S. von § 13 WpHG in der bis zum 1. Juli 2016 gültigen Fassung gehandelt habe (im Folgenden WpHG a. F.),
- ob diese Insiderinformationen von der Beklagten unverzüglich gem. § 15 WpHG a. F. hätten veröffentlicht werden müssen (Ad-hoc-Mitteilung),
- ob bestimmte Geschäfts- und Halbjahresberichte sowie Ad-hoc-Mitteilungen unrichtig waren, weil in ihnen die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der Abgasmanipulation verschwiegen wurden,
- und ob sich die Beklagte gegenüber den Klägern schadensersatzpflichtig gemacht hat wegen der unterlassenen unverzüglichen Veröffentlichung gem. § 37b WpHG, der Veröffentlichung unwahrer Insiderinformationen gem. § 37c WpHG und wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung durch die Beeinflussung von Anlageentscheidungen gem. § 826 BGB.
Die Kläger behaupten, dass der Entschluss zum Einsatz der Manipulationssoftware „Defeat Device“ bereits 2005 und 2006, spätestens aber 2007 bei der Entwicklung des betroffenen Dieselmotors VW EA 189 gefällt worden sei. Zudem sei die Beklagte sowohl 2007 durch eine Warnung des Zulieferers Bosch als auch 2011 durch einen Techniker auf die Manipulationssoftware hingewiesen worden. Der Vorstand der VW AG habe spätestens im Mai 2014 aufgrund von Prüfungen US-amerikanischer Umweltbehörden davon Kenntnis erlangt.
Die Beklagte behauptet, dass es sich um einen gestreckten Sachverhalt gehandelt habe, der sich erst mit der Mitteilung der EPA am 18. September 2015 zu einer Insiderinformation verdichtet habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe die Beklagte davon ausgehen können, dass die Ermittlungen der US-Umweltbehörden mit einem Vergleich enden und daher keine größere Kursrelevanz haben würden, zumal man davon ausging, dass das Problem auf den US-Markt beschränkt sei.
Die Entscheidung zum Einsatz der Software sei von Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene auf nachgeordneten Arbeitsebenen des Bereichs Aggregate-Entwicklung getroffen worden. Der Vorstand habe erst im Sommer 2015 von der Thematik erfahren. Außerdem sei die Beklagte wegen eines überwiegenden Geheimhaltungsinteresses gem. § 15 Abs. 3 WpHG a. F. von der Pflicht zur unverzüglichen Veröffentlichung von Insiderinformationen befreit gewesen.
Deutschland/Russland – OLG Hamburg: Mangels Gegenseitigkeit keine Anerkennung russischer Urteile in Deutschland
Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hat entschieden, dass Entscheidungen russischer Gerichte in Deutschland weder anerkannt noch vollstreckt werden können, da die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist (Urt. v. 13.7.2016, Az.: 6 U 152/11).
Im zugrunde liegenden Fall hatte die Klägerin als Bareboat Charterer eines Schiffs die Beklagte vor dem Arbitragegericht (Wirtschaftsgericht) Moskau auf Zahlung aus einer Schiffsversicherung („Owner‘s Protection & Indemnity Insurance“) verklagt. Der Streitwert belief sich auf umgerechnet EUR 377.418. Das Arbitragegericht Moskau verurteilte die Beklagte am 13. März 2009 zur Zahlung von EUR 473.423 nebst Gerichtskosten in Höhe von EUR 1.160. Die Rechtsmittel der Beklagten blieben erfolglos.
Das Landgericht Hamburg wies den Antrag der Klägerin auf Vollstreckbarkeitserklärung des Urteils zurück, u. a. da im Verhältnis zwischen Deutschland und der Russischen Föderation die Gegenseitigkeit nicht verbürgt sei.
Das OLG Hamburg wies die Berufung der Klägerin zurück. In Ermangelung allgemeiner Abkommen zur Anerkennung von Urteilen zwischen Deutschland und Russland richtet sich die Anerkennung nach § 328 ZPO. Selbst wenn man mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des internationalen Rechtsverkehrs einen großzügigen Maßstab anlegen würde, sei die Gegenseitigkeit i. S. von § 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nicht verbürgt, wie sich aus dem vom OLG eingeholten Gutachten ergibt:
Anders als im ursprünglichen Entwurf zur Reform der russischen Zivil- und Arbitrageprozessordnung von 2002 vorgesehen, ist die Möglichkeit der Anerkennung und Vollstreckung auf Basis der Verbürgung der Gegenseitigkeit nicht ins Gesetz aufgenommen worden.
Die russischen Arbitragegerichte hätten zwar in allen Instanzen in einer Reihe von Entscheidungen geurteilt, dass es auch ohne entsprechende völkerrechtliche Verträge möglich sei, die Entscheidungen ausländischer Gerichte anzuerkennen, wenn die Gegenseitigkeit verbürgt sei. Es gebe aber weder verbindliche Auslegungshinweise des Plenums noch entsprechende Informationsbriefe des Präsidiums des Obersten Arbitragegerichts.
Die restriktive Anerkennungspraxis der allgemeinen Gerichte in Russland, die eine völkerrechtliche Grundlage voraussetzt, ist vom russischen Verfassungsgericht mit Entscheidung vom 17. Juli 2007 gebilligt worden. Nach Ansicht des Sachverständigen könne man diese Entscheidung aber auch so verstehen, dass die Auslegung der russischen ZPO durch die ordentlichen Gerichte nicht verfassungswidrig sei, die Entscheidungen der russischen Arbitragegerichte aber nicht zwingend einen Verfassungsbruch darstellen würden.
Auch nach dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts und nach der Zusammenlegung des Obersten Arbitragegerichts mit dem Obersten Gerichtshof im Jahr 2014 sind Entscheidungen der Arbitragegerichte ergangen, die die Gegenseitigkeit für eine Anerkennung als ausreichend erachteten. Eine Entscheidung des Plenums zu dieser Frage gebe es aber noch nicht.
Eine Entscheidung, in der ein deutsches Urteil in Russland anerkannt wurde, ist nicht bekannt. Bisher seien nur englische/nordirische, niederländische und belgische Entscheidungen anerkannt worden. Der Antrag auf Anerkennung eines vor dem Kammergericht Berlin geschlossenen Vergleichs sei u. a. deshalb zurückgewiesen worden, weil die Antragstellerin keine Beispiele für die Vollstreckung russischer Urteile durch deutsche Gerichte vorgelegt habe.
Das OLG Hamburg kam zu dem Schluss, dass deutsche Gerichte bei der Anerkennung von Urteilen nicht den ersten Schritt machen sollten, da offen sei, wie russische Gerichte im umgekehrten Fall entscheiden würden. Es sei nach Ansicht des Sachverständigen zwar möglich, dass eine Anerkennung durch das OLG Hamburg in Russland als Schlüsselentscheidung wahrgenommen werden würde, doch sei schwer einzuschätzen, wie sich ein solches Urteil auf die Anerkennungspraxis in Russland auswirken würde.
Mexiko – Pflichtversicherung für die Umwelthaftung im Kohlenwasserstoffsektor
Am 24. Juni 2016 sind neue Richtlinien der mexikanischen Umweltbehörde ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) zum Pflichtversicherungsschutz in der Kohlenwasserstoffindustrie in Kraft getreten.
Unternehmen, die in der Kohlenwasserstoffindustrie tätig sind und die Genehmigung erhalten haben, ein bestimmtes Projekt in diesem Bereich durchzuführen, müssen ihre Betriebshaftpflicht- und Umwelthaftpflichtpolicen an die Vorgaben der Richtlinie anpassen und diese bei der ASEA anmelden. Auftragnehmer und Subunternehmer müssen ebenfalls vom Versicherungsschutz erfasst sein oder über eigene Policen mit gleicher Deckung verfügen.
Erlaubt sind nur Policen von Versicherern, die in Mexiko behördlich zugelassen sind. Die Pflichtversicherung muss Dritten einen Direktanspruch gegen den Versicherer gewähren und außerdem einen Regressverzicht zugunsten des mexikanischen Staats enthalten. Selbstbehalte sind nicht vorgesehen.
Die Policen müssen folgende Tätigkeiten versichern:
- Bohrlochkontrolle im Zusammenhang mit Exploration und Gewinnung
- Haftung für Umweltschäden im Zusammenhang mit Exploration und Gewinnung
- Haftung für Umweltschäden im Zusammenhang mit Der Aufbereitung, Raffination und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas.
Gedeckt sein müssen u. a. die Kosten von:
- Notfallmaßnahmen
- Kontrollen von Kontaminationen
- Umweltschäden und Schadenminderungsmaßnahmen
- Sanierung von kontaminierten Grundstücken
- Wiederherstellung oder Kompensation.
Spezifische Deckungsanforderungen richten sich nach dem jeweiligen Standort, dem Fördervolumen und dem verwendeten technischen Gerät.
Die Versicherungssumme für die Betriebs- und Umwelthaftungsversicherung muss entweder zwischen USD 25 Mio. und USD 1 Mrd. für alle Schadensfälle eines Jahres betragen oder anhand des wahrscheinlichen Höchstschadens ermittelt werden. Die Richtlinie sieht für Tiefbohrungen zu Lande eine Versicherungssumme von USD 25 bis 100 Mio. vor, für Bohrungen im Flachwasser USD 500 Mio. und für Tiefseebohrungen USD 700 Mio. Zusätzlich muss der Betreiber eine Police für die Bohrlochkontrolle unterhalten, deren Deckungssumme das 1,5 bis 6-Fache der Betriebskosten (authority for expenditure) des Bohrlochtyps beträgt. Werden Schiffe oder Bohrplattformen eingesetzt, betragen die Versicherungssummen USD 5 Mio. bis 1 Mrd.
Bei Zahlungen aus der Pflichtversicherung müssen die Versicherer der ASEA innerhalb von 30 Tagen alle Informationen zum Versicherungsfall mitteilen. Alle Änderungen oder Kündigungen der Policen müssen der ASEA ebenfalls gemeldet werden.
USA – USD 11,9 Mio. Schadensersatz nach Selbsttötung eines Antidepressivapatienten
Die Jury des U.S. District Court for the Middle District of Pennsylvania hat am 15. September 2016 der Witwe und dem Sohn eines Mannes, der sich in der Haft das Leben nahm, Schadensersatz gegen PrimeCare Medical, Inc., den Träger der medizinischen Versorgung der Justizvollzugsanstalt, sowie die beim Träger angestellten Psychiater, Psychologen und Krankenschwestern zugesprochen (Peter Ponzini, et al. v. Monroe County, et al., Case No.: 3:11-CV-00413)
Den Klägern Miryem Barbaros und Peter Ponzini wurde Schadensersatz in Höhe von USD 1.057.344 wegen bedingt vorsätzlicher Schädigung durch Bundesangestellte (federal deliberate indifference) sowie in Höhe von USD 2,8 Mio. wegen Arzthaftung (medical negligence) nach dem Wrongful Death Act und dem Survival Act von Pennsylvania zugesprochen. Gegen PrimeCare Medical wurden außerdem USD 8 Mio. Punitive Damages wegen Arzthaftung (medical negligence) nach dem Wrongful Death Act und dem Survival Act verhängt.
Der damals 46-jährige bulgarisch-stämmige M war 2009 verhaftet und in die Monroe County Correctional Facility eingewiesen worden, nachdem er den Gastronomiebetrieb eines Konkurrenten mutwillig zerstört hatte, und wartete nun auf seine Entlassung auf Kaution. Er litt unter Depressionen, die seit etwas sechs Jahren mit dem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Paxil (Wirkstoff Paroxetin) sowie dem dämpfenden Antidepressivum Trazodon (zur Schlafförderung) behandelt wurden, und hatte bei seiner Inhaftierung auch auf diese Medikamentation hingewiesen. Aufgrund einer Reihe von Irrtümern seitens des medizinischen Personals der Justizvollzugsanstalt erhielt er jedoch vier Tage lang keine Medikamente. Obwohl er am zweiten und dritten Tag seiner Haft an Kopfschmerzen und Bluthochdruck litt und sich seine chronischen Magenprobleme verschlimmerten, wurde dies nicht auf Entzugssymptome zurückgeführt. Als seine Verschreibungen schließlich bestätigt wurden, rief eine Gefängnis-Krankenschwester den zuständigen Psychiater an und bat ihn, ohne Näheres zum Patienten mitzuteilen, diesem 30 mg Paxil und 100 mg Trazodon zu verschreiben. Der Psychiater kam dem ohne weitere Rückfragen nach.
Nachdem M seine erste Dosis Paxil am Morgen bekommen hatte, zeigte er sich beim Routinebesuch des Gefängnispsychologen am Nachmittag extrem agitiert sowie schweigsam und verschlossen. Der Psychologe unterließ es, die Krankenakte zu prüfen, aus der sich die abrupte Verhaltensänderung ergeben hätte, und erkundigte sich nicht nach Selbsttötungsgedanken. Am nächsten Tag wurde M tot aufgefunden.
Der von den Klägern im Schadensersatzprozess benannte Sachverständige kritisierte, dass der zuständige Psychiater weder Informationen über den Patienten eingeholt noch ihn aufgesucht und auch keine spezielle Überwachung angeordnet hatte, obwohl ihm bekannt gewesen sei, dass das Medikament laut den bei der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Marktzulassung vorgelegten Studien einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit Selbsttötungen bei Erwachsenen aufwies.
Nach Ansicht des Sachverständigen hatte die abrupte Dosis von 30 mg Paxil nach viertägiger Einnahmepause, in der der Wirkstoffpegel im Körper des Patienten stark gesunken war, zu Akathisie (Agitation mit Hyperaktivität) und Selbsttötung geführt. Aus den Krankenunterlagen des Patienten ergab sich, dass M, als er vor sechs Jahren seine erste Dosis Paxil von 10 mg erhielt, am nächsten Tag eine derart schwere Angstattacke erlitt, dass er wegen des Verdachts auf Herzinfarkt einen Notfallkardiologen aufsuchte, ohne jedoch seine Unruhe auf das Antidepressivum zurückzuführen.
Ausgabe von September 2016
Deutschland – OLG Oldenburg: Keine Zuständigkeit deutscher Gerichte für Rückzahlungsforderungen aus Griechenlandanleihen
Das Oberlandesgericht Oldenburg hat entschieden, dass für eine Klage von Gläubigern griechischer Staatsanleihen gegen die Hellenische Republik kein Gerichtsstand in Deutschland besteht (Urteil v. 18. April 2016, Az.: 13 U 43/15).
Durch ein griechisches Gesetz waren 2012 griechische Staatsanleihen zwangsumgetauscht worden, sodass sie 53,5 % ihres Nennwerts verloren. Deutsche Gläubiger erhoben daraufhin vor dem LG Osnabrück Klage gegen die Hellenische Republik auf (u. a.) Rückzahlung des Nennbetrags der ursprünglichen Anleihen nebst Zinsen. Das LG Osnabrück wies die Klage als unzulässig ab, weil die Hellenische Republik Staatenimmunität genieße und somit keine Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit bestehe.
Das OLG Oldenburg wies die Berufung als unbegründet zurück:
I. Soweit die Kläger vertragliche Rückzahlungsansprüche gegen die Hellenische Republik geltend machten, greife der Einwand der Staatsimmunität nicht. Die Kapitalaufnahme durch die Emission von Staatsanleihen werde nach ganz überwiegender Auffassung zum Kreis nicht hoheitlichen Handelns gerechnet. An diesem nicht hoheitlichen Charakter des Rechtsverhältnisses änderten auch spätere Maßnahmen hoheitlicher Natur (wie das Gesetz, das den Zwangsumtausch ermöglichte) nichts.
1. Da das Klageverfahren vor dem 10. Januar 2015 eingeleitet worden war, sei die Zuständigkeit nach der EuGVVO a. F. (Brüssel I-Verordnung) zu prüfen.
a) Der Verbrauchergerichtsstand gem. Art. 15 Abs. 1 c, Art. 16 Abs. 1 EuGVVO a. F. greife nicht, weil dieser voraussetze, dass der Vertrag bereits mit einem Verbraucher geschlossen worden sei. Im vorliegenden Fall hätten die Kläger ihre Forderungen aber erst durch Übertragung von einem Träger, nämlich der Deutschen Bank AG, erworben.
b) Ebenso wenig greife der besondere Gerichtsstand des Erfüllungsorts gem. Art. 5 Nr. 1 a EuGVVO a. F. Die Begriffe „Vertrag“ und „Ansprüche aus einem Vertrag“ seien weit auszulegen, so dass auch eine – wie im vorliegenden Fall – gesetzlich angeordnete unmittelbare Verpflichtung gegenüber den Investoren als Anspruch aus Vertrag i. S. der Verordnung anzusehen sei.
Der Erfüllungsort sei nach dem kollisionsrechtlich anzuwendenden materiellen Recht zu bestimmen. Im vorliegenden Fall sei dies unstreitig nach den Anleihebedingungen das griechische Recht. Aus diesem ergebe sich, dass die wechselseitigen Verpflichtungen zwischen der Hellenischen Republik und dem Träger, von denen die Kläger die Forderungen erworben hatten, am Sitz der griechischen Zentralbank zu erfüllen seien.
Selbst bei Anwendung der dispositiven Vorschrift des Art. 321 des griechischen Zivilgesetzbuchs (GR-ZGB) sei Erfüllungsort der Wohnort bzw. der Ort der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers. Wegen des Umfangs und des Gewichts der Funktionen, die die Deutsche Bank AG im Zusammenhang mit der Ausgabe der Staatsanleihen durch den griechischen Staat gehabt haben soll, sei deren Erfüllung ohne eine zum selbständigen Geschäftsabschluss befugte Niederlassung in Griechenland nicht möglich. Daher sei der Ort dieser gewerblichen Niederlassung und nicht der in Deutschland gelegene Hauptsitz der Deutschen Bank AG Erfüllungsort i. S. des Art. 321 GR-ZGB.
Der an diesen vertraglichen Erfüllungsort geknüpfte Gerichtsstand könne nicht durch Übertragung der Forderung verändert werden. Wegen des Grundsatzes der Vorhersehbarkeit des Gerichtsstands blieben alleine die in der Person des ursprünglichen Gläubigers liegenden Umstände relevant.
II. Soweit die Kläger ihre Ansprüche hilfsweise auf vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, rechtswidrige Enteignung oder enteignungsgleichen Eingriff stützen, stehe dem der Einwand der Staatenimmunität entgegen.
Ebenso entschied in einem gleich gelagerten Fall das OLG Köln (Urteil v. 12. Mai 2016, Az. 8 U 44/15). Gegen beide Urteile wurde Revision beim BGH eingelegt (Az. XI ZR 217/16 bzw. XI ZR 247/16).
Deutschland – OLG Köln: Kein Schmerzensgeld für Ehefrau wegen sexueller Dysfunktion des Ehemanns
Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass eine Ehefrau keinen eigenen Anspruch auf Schmerzensgeld hat, wenn ihr Ehemann aufgrund einer ärztlichen Behandlung eine Beeinträchtigung der Geschlechtsfunktion erleidet (Beschluss v. 22. Dezember 2015, Az.: 5 U 135/15).
Der Ehemann der Klägerin hatte sich wegen abdomineller Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben. Aufgrund einer Unterleibsoperation und der nachfolgenden medikamentösen Behandlung erlitt er eine Beeinträchtigung seiner Geschlechtsfunktion. Seine Ehefrau forderte daraufhin ebenfalls ein Schmerzensgeld. Das LG Köln wies die Klage der Ehefrau ab (Az.: 25 O 380/14).
Das OLG Köln teilte den Parteien mit, dass es die Berufung der Klägerin gem. § 522 Abs. 2 ZPO wegen fehlender Aussicht auf Erfolg zurückweisen werde.
I. Für einen Anspruch aus dem Behandlungsvertrag nach den Grundsätzen eines Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter fehle es bereits an der erforderlichen Leistungsnähe. Leistungsnähe liege vor, wenn der Dritte bestimmungsgemäß mit der vertraglichen Hauptleistung in Berührung kommt und nach der Anlage des Vertrags den Leistungsgefahren in ähnlicher Weise ausgesetzt ist wie der Gläubiger selbst. Vorliegend sei die Klägerin jedoch allenfalls mittelbar betroffen. Nur in engen Ausnahmefällen – wie in denen einer fehlgeschlagenen Sterilisation –, in denen der Vertrag nach seinem Vertragszweck erkennbar drittbezogen ist und auch darauf abzielt, Schäden eines Dritten zu vermeiden, könne davon ausgegangen werden, dass sich die vertragliche Haftung auch auf den Dritten erstrecken soll. Der Umstand, dass die Behandlung auch zu einer Beeinträchtigung der Geschlechtsfunktion und damit faktisch des ehelichen Zusammenlebens führen könne, rechtfertige keine Einbeziehung der Klägerin in den Schutzbereich des Vertrags.
Zudem fehle es an einem eigenen Schaden der Klägerin. Eine eigene Gesundheitsverletzung habe die Klägerin nicht schlüssig vorgetragen. Und selbst wenn man eine Einschränkung des sexuellen Selbstbestimmungsrechts der Klägerin als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bejahen würde, könne auch dies keinen Schmerzensgeldanspruch der Klägerin auslösen, da nach der Rechtsprechung des BGH eine Haftung des Arztes aus einer Behandlung zwingend eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit erfordere.
II. Die Klägerin habe auch keinen deliktischen Anspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB, da es an einer Rechtsgutverletzung fehle und auch kein Zurechnungszusammenhang bestehe. Die von der Klägerin vorgetragenen Beeinträchtigungen unterfielen dem allgemeinen Lebensrisiko. Mittelbare Beeinträchtigungen, die ein Dritter durch einen Eingriff in ein fremdes Rechtsgut erleidet, können nur in Ausnahmefällen – z. B. in den sog. Schockschadenfällen – eine Haftung des Schädigers gegenüber Dritten begründen. Vorliegend fehle es jedoch schon an einer schlüssigen Darlegung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung mit echtem Krankheitswert.
USA – FDA erweitert Zuständigkeit auf alle Tabakprodukte
Seit dem 8. August 2016 erstreckt sich die Zuständigkeit der U.S. Food and Drug Administration (FDA) auch auf E-Zigaretten, Wasserpfeifen, Zigarren und Pfeifentabak („Deeming Tobacco Products to Be Subject to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act“ v. 10. Mai 2016 - 81 FR 28973).
Gemäß dem Tobacco Control Act ist die FDA zuständig für die Regulierung von Zigaretten, Zigarettentabak, Tabak zum Selberdrehen, Kau- und Schnupftabak sowie Tabakprodukte, für die sich die FDA per Verordnung für zuständig erklärt hat. Die Zuständigkeit der FDA bezieht sich auf Komponenten und Bestandteile („component or part“) der Tabakprodukte, nicht jedoch auf Zubehör („accessory“).
Zu den in die Zuständigkeit der FDA fallenden Komponenten und Bestandteilen von elektronischen Nikotinzuführungssystemen („electronic nicotine delivery systems“) gehören beispielsweise Liquide, Verdampfer, Batterien, Display/Lichter für die Einstellungen des Geräts, Aromastoffe, Behältnisse für die Liquids sowie Software. Zu den Komponenten bzw. Bestandteilen von Wasserpfeifentabak gehören u. a. Geschmacksverstärker, Abkühlungsvorrichtungen für den Schlauch, Zusätze für die Wasserfilterung, aromatisierte Wasserpfeifenkohle und deren Verpackung, Gefäße, Röhren, Schläuche und Kopfstücke.
Reine Zubehörteile, die nicht der Regulierung unterfallen, sind z. B. Aschenbecher, Spucknäpfe, Pfeifenbeutel oder Humidore.
In den Zuständigkeitsbereich der FDA gehören auch Tabakprodukte, die erst zukünftig entwickelt werden, wie z. B. Nikotinprodukte, die – ähnlich wie derzeit auf dem Markt befindliche medizinische Mittel zur Nikotinentwöhnung – durch dermale Absorption oder als Nasenspray zugeführt werden, aber weder Arzneimittel noch Medizinprodukte sind.
Mit Inkrafttreten der Verordnung wird die FDA auch bei den neu aufgenommenen Tabakprodukten zuständig sein für
- Maßnahmen gegen verfälschte oder falsch deklarierte Produkte,
- die Vorlage von Auflistungen von Inhaltsstoffen und Berichten über tatsächlich und möglicherweise gesundheitsschädliche Bestandteile („harmful and potentially harmful constituents“),
- die Registrierung von Produktionsstätten und Produktlisten,
- ein Verbot des ungenehmigten Verkaufs und Vertriebs von Produkten mit Risikobeschreibungen wie „leicht/light“, „niedrig/low“ oder „mild“,
- ein Verbot der Abgabe von kostenlosen Probepackungen und
- Prüfungen vor Markteinführung.
Des Weiteren gelten die folgenden Einschränkungen nicht nur für Tabakprodukte, die Tabak oder Nikotin enthalten, sondern auch für Tabakprodukte, die Tabakderivate enthalten:
- Mindestalter für den Erwerb
- Gesundheitswarnungen für die Verpackungen und die Werbung sowie
- Verbot von Verkaufsautomaten (ausgenommen sind Standorte, bei denen durch den Verkäufer sichergestellt ist, dass Personen unter 18 Jahren jederzeit am Zugriff gehindert sind).
Für die Gesundheitswarnhinweise gilt eine 24-Monats-Frist ab Verkündung der Verordnung mit einer 30-tägigen Abverkaufsfrist für Produkte, die noch nicht die Warnhinweise auf der Verpackung haben.
USA – USD 5,6 Mio. wegen Krebserkrankung durch mit Perfluoroctansäure kontaminiertes Trinkwasser
In einem dritten sog. Bellwether Trial in der Multidistrict Litigation gegen den U.S.-amerikanischen Chemiekonzern E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) hat eine Jury des U.S. District Court, Southern District of Ohio, einem an Hodenkrebs erkrankten Kläger USD 5,1 Mio. als kompensatorischen und USD 500.000 als Strafschadensersatz (Punitive Damages) zugesprochen (In re: E. I. du Pont de Nemours and Company C-8 Personal Injury Litigation, MDL 2433).
Über 3.500 Verfahren gegen DuPont waren am 9. April 2013 zu einem Multidistrict-Verfahren zusammengefasst worden. Die Kläger klagen wegen Gesundheitsschäden und Todesfällen aufgrund von Trinkwasser, das mit Perfluoroctansäure (abgekürzt: PFOA oder C8) verunreinigt war, die aus dem DuPont-Washington-Werk in Parkersburg, West Virginia, stammte. PFOA wurde bis zum Jahr 2000 in der Teflonherstellung benutzt.
Gegen DuPont war 2005 ein Bußgeld in Höhe von USD 16,5 Mio. verhängt worden, weil das Unternehmen der U.S. Environmental Protection Agency u. a. nicht mitgeteilt hatte, dass eine unternehmensinterne Studie Geburtsschäden bei den Kindern der im Werk tätigen Arbeiter festgestellt hatte. Dass PFOA giftig ist, war DuPont bereits 1961 bekannt. Laut den Klägeranwälten wusste DuPont zudem seit 1984, dass PFOA ins Trinkwasser gelangt.
Im ersten von sechs geplanten Bellwether-Verfahren sprach eine Jury der Klägerin Clara Bartlett USD 1,6 Mio. als kompensatorischen Schadensersatz zu, aber keine Punitive Damages. DuPont legte gegen das Urteil Berufung ein.
Das zweite Bellwether-Verfahren wurde Anfang 2016 mit einem Vergleich beigelegt, dessen Einzelheiten nicht bekannt sind.
Im jetzigen Verfahren (David Freemen v. E. I. du Pont de Nemours and Company, Case No. 2:13-cv-1103) sprach die Jury dem 56-jährigen Kläger aufgrund fahrlässiger Schädigung („negligence“) am 6. Juli 2016 USD 5,1 Mio. als kompensatorischen Schadensersatz zu. Die Jury stellte ußerdem fest, dass DuPont arglistig gehandelt hatte („actual malice“). Am 11. Juli 2016 erging ein richterliches Urteil, wonach der Kläger zusätzlich USD 500.000 Punitive Damages erhält. DuPont kündigte an, auch gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.
Das Unternehmen Chemours Company, das im Juli 2015 von DuPont abgespalten wurde, hat die Verbindlichkeiten DuPonts aus den anhängigen Schadensersatzverfahren übernommen. Unklar ist, ob dies auch für Strafschadensersatzforderungen gilt.
Ausgabe von Mai 2016
Frankreich – Keine Entschädigung für Bluterkrankung nach Pestizid- und Herbizideinsatz
Die Cour d’Appel in Metz hat am 21. April 2016 die Klage eines 58-jährigen Landwirts zurückgewiesen, der nach der Verwendung benzolhaltiger Pestizide und Herbizide an myeloproliferativer Neoplasie erkrankt war.
Beim Kläger war 2002 myeloproliferative Neoplasie diagnostiziert worden. Diese Erkrankung kann in eine akute myeloische Leukämie übergehen. Gutachten bestätigten, dass seine Erkrankung durch Benzol, das in Pestiziden und Herbiziden enthalten ist, ausgelöst wurde. 2006 wurde die Erkrankung des Klägers vom Tribunal des affaires de la sécurité sociale (Sozialgericht) d’Epinal als Berufskrankheit anerkannt.
2012 machte der Kläger Ansprüche gegen die Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) geltend, um keine direkten Klageverfahren gegen alle betreffenden Pestizidhersteller führen zu müssen. Er begründete seine Ansprüche gegen den staatlichen Garantiefonds damit, dass auf der Verpackung der Pestizide sowohl ein Hinweis auf Benzol als auch auf notwendige Schutzmaßnahmen fehlte.
Die Cour d’Appel in Nancy kam zu dem Schluss, dass die Hersteller nicht ignorieren konnten, dass ihre benzolhaltigen Produkte die Verwender einem erheblichen Risiko dieser Bluterkrankung aussetzten, und sprach dem Kläger die geforderte Entschädigung zu. Dieses Urteil wurde 2015 aufgrund der Revision des französischen Staats vom Cour de cassation aufgehoben, weil die Verordnung von 1943, nach der die fehlende Kennzeichnung rechtswidrig war, 1999 aufgehoben worden war. Zudem hätte die Cour d’Appel in Nancy die Haftung der Hersteller nach den zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Produkte geltenden Vorschriften beurteilen müssen. Die Cour de cassation verwies den Rechtsstreit zurück an die Cour d’Appel in Metz.
Die Cour d’Appel in Metz wies die Klage nun ab. Es gebe keine ausreichenden Beweise dafür, dass die Bluterkrankung des Klägers durch Benzol verursacht worden war.
Der Kläger überlegt, gegen das Urteil Revision einzulegen.
Österreich – Gefährdungshaftung des Bauherren für umstürzenden Baukran
Das Oberlandesgericht Wien hat entschieden, dass ein Bauherr für Schäden durch einen umgestürzten Baukran verschuldensunabhängig haftet (7. April, 2016, Az.: 11R18/16x).
In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2014 war in Wien-Josefstadt ein Turmdrehkran, dessen behördliche Genehmigung seit zwei Jahren abgelaufen war, auf das gegenüberliegende Haus gestürzt, nachdem die Stahlbeton-Fundamentplatte gebrochen war. Ob der Straßengrund aufgrund einer Auswaschung nachgegeben hatte oder dem Bauunternehmer Versäumnisse unterlaufen waren, konnte nicht geklärt werden.
Das OLG Wien bestätigte das Urteil der ersten Instanz, das dem geschädigten Hausherrn Schadensersatz in Höhe von rund EUR 400.000 gegen den Bauherrn zugesprochen hatte. In analoger Anwendung des § 364a ABGB hafte der Bauherr auch dann, wenn die Anlage nicht auf seinem Grundstück, sondern auf öffentlichem Grund aufgestellt wurde. Schon die Baubewilligung sei als behördliche Anlagegenehmigung zu werten.
§ 364a. Wird jedoch die Beeinträchtigung durch eine Bergwerksanlage oder eine behördlich genehmigte Anlage auf dem nachbarlichen Grund in einer dieses Maß überschreitenden Weise verursacht, so ist der Grundbesitzer nur berechtigt, den Ersatz des zugefügten Schadens gerichtlich zu verlangen, auch wenn der Schaden durch Umstände verursacht wird, auf die bei der behördlichen Verhandlung keine Rücksicht genommen wurde.
Das Aufstellen eines Krans im dicht bebauten Gebiet schaffe eine besondere Gefahrensituation. Das Umfallen des Krans stelle kein völlig untypisches Risiko dar, und die beiden möglichen Ursachen für den Bruch der Fundamentplatte seien auch keine untypischen Folgen des Betriebs eines Baukrans. Der Bauherr könne ggf. Regress beim Bauunternehmer nehmen.
Das OLG Wien hat eine Revision nicht zugelassen.
USA – Berufungsgericht bestätigt Vergleich zwischen NFL und Footballspielern wegen neurodegenerativer Erkrankungen
Der U.S. Court of Appeals for the Third Circuit in Philadelphia hat am 18. April 2016 einen Vergleich zwischen der National Football League (NFL) und ehemaligen Footballspielern bestätigt (In Re: National Football League Players Concussion Injury Litigation nebst Korrektur vom 2. Mai 2016).
In dem Vergleich verpflichtet sich die NFL ohne ein Schuldeingeständnis, den Spielern, die berufsbedingt Gehirnerschütterungen und Stöße gegen den Kopf erlitten hatten und nun an neurodegenerativen Erkrankungen leiden, eine Entschädigung von bis zu USD 5 Mio. (je nach Symptomen, Alter und Anzahl der aktiven Jahre in der NFL) zu zahlen. Hierfür steht ein Fonds mit USD 675 Mio. zur Verfügung, der aber nicht gedeckelt ist. Für medizinisches Monitoring steht ein weiterer Fonds mit USD 75 Mio. bereit, der ebenfalls nicht gedeckelt ist. Die NFL schätzt ihre Verpflichtungen aus dem Vergleich auf maximal USD 900 Mio.
Bei etwa drei von zehn ehemaligen Spielern bildete sich infolge der Kopfverletzungen neurodegenerative Erkrankungen aus. Die Spieler erkrankt an Alzheimer, amyotropher Lateralsklerose (ALS), Parkinson, Demenz oder chronischer traumatischer Enzephalopathie (CTE).
Erste Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Gehirnerschütterungen und anderen traumatischen Kopfverletzungen bei Sportveranstaltungen wurden im Jahr 2011 eingereicht. Die gegen die NFL gerichteten Sammelklagen wurden zu einer Multi-District-Litigation vor dem U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania zusammengefasst. Am 7. Juli 2014 bestätigte der District Court den Vergleich zwischen der NFL und den Spielern (ausführlich zu den Klageverfahren und den damit verbundenen Deckungsfragen Midlige/Hrinewski, PHi 2014, 220 ff. und 2015, 26 ff.). Am 22. April 2015 wurde dieser Vergleich noch einmal revidiert. Mehr als 98 % der vom Vergleich betroffenen ehemaligen Footballspieler waren damit einverstanden, einige Kläger legten jedoch Berufung ein.
Die Berufungskläger kritisierten, dass die NFL in dem Vergleich nicht zugeben musste, dass ihr die Gefahren wiederholter Kopfverletzungen bekannt waren. Des Weiteren wollten die Berufungskläger erreichen, dass auch Spieler, die an CTE leiden (oder litten) ohne Zeitgrenze von dem Vergleich erfasst werden. Der jetzige Vergleich berücksichtigt nur Spieler, bei denen vor dem Vergleichsabschluss CTE diagnostiziert worden war. Diagnostiziert werden kann CTE erst nach dem Tod des Betroffenen, nach Ansicht des NFL sind aber die mit dieser Erkrankung verbundenen Beschwerden wie Gedächtnisverlust und Depressionen von dem Vergleich gedeckt. Zudem enthält der Vergleich eine Klausel, wonach der Umgang mit CTE in der Vergleichsvereinbarung noch einmal von der NFL und den Spielern überprüft werden kann.
Der Court of Appeals befand am 18. April 2016, dass der Vergleich zwar nicht perfekt, aber billig und angemessen sei. Insbesondere ließen die Regelungen zu CTE den Vergleich nicht als grundlegend unbillig erscheinen.
Am 28. April 2016 beantragten rund 1 % der Kläger eine weitere Überprüfung des Vergleichs durch den Court of Appeals en banc, also durch den kompletten Senat.
USA – Millionenentschädigungen wegen Krebserkrankungen aufgrund talkumhaltigen Körperpuders
Eine Jury des 22nd Circuit Court in St. Louis, Missouri, hat am 2. Mai 2016 entschieden, dass Johnson & Johnson Schadensersatz in Höhe von USD 55 Mio. an die Klägerin R zahlen muss, die aufgrund des Gebrauch von talkumhaltigen Körperpuders an Eierstockkrebs erkrankt ist (Hogans v. Johnson & Johnson, 1422-CC09012-01).
Am 23. Juni 2014 war bei dem Gericht eine Sammelklage von ca. 60 Personen eingereicht worden, angeführt von der Klägerin H. Die Klage richtet sich gegen Johnson & Johnson, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., Imerys Talc America, Inc. f/k/a Luzenac America, Inc. und Personal Care Products Council f/k/a Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA).
Die 62-jährige Klägerin R hatte die talkumhaltigen Puderprodukte der Beklagten (Shower-to-Shower und Johnson’s Baby Powder) über fast 40 Jahre hinweg in ihrem Genitalbereich benutzt. 2011 wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. Aufgrund ihrer Krebserkrankung musste sie sich einer Hysterektomie und weiterer Unterleibsoperationen unterziehen. Der Krebs ist mittlerweile in Remission.
Die Jury befand in einer 9:3-Entscheidung, dass Johnson & Johnson fahrlässig gehandelt habe, und sprach R USD 5 Mio. als kompensatorischen und weitere USD 50 Mio. Punitive Damages (Strafschadensersatz) zu. Johnson & Johnson sei sich seit Mitte der 1970er-Jahre der Gesundheitsbedenken bewusst gewesen und habe dennoch bis 1992 seine Talkum-Produkte gezielt für Frauen beworben.
Eine Haftung des ebenfalls beklagten Talkum-Lieferanten von Johnson & Johnson, Imerys Talc America, verneinte die Jury.
Johnson & Johnson hält die Produkte für sicher und will gegen das Urteil Berufung einlegen. Ob Talkumpuder krebserregend ist, ist unklar. Die International Agency for Research on Cancer (IARC) klassifizierte 2006 Talkumpuder bei Anwendung im Genitalbereich wegen der widersprüchlichen Studienlage als „möglicherweise krebserregend“.
Im Februar 2016 hatte eine Jury in demselben Verfahren der Familie einer Frau, die nach jahrzehntelanger Benutzung talkumhaltiger Puderprodukte im Genitalbereich 2015 mit 62 Jahren an Eierstockkrebs gestorben war, USD 72 Mio. zugesprochen. Johnson & Johnson hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.
Insgesamt sind gegen Johnson & Johnson rund 1.200 Klagen wegen talkumhaltiger Produkte anhängig.
Ausgabe von März 2016
Niederlande/Deutschland – Entschädigung für Volkswagenaktionäre wegen Dieselaffäre
Anfang 2016 wurde die niederländische Volkswagen Investor Settlement Foundation (Stichting Volkswagen Investor Settlement) gegründet, um für Investoren, deren Volkswagen-Aktien aufgrund der Dieselaffäre an Wert verloren haben, mit der Volkswagen AG einen kollektiven Vergleich nach niederländischem Recht (Wet collectieve afwikkeling van massaschades, WCAM) auszuhandeln. Der Gerechtshof Amsterdam (Amsterdamer Berufungsgericht) soll den erzielten Vergleich danach für alle Investoren weltweit für anwendbar erklären. Die Volkswagen AG selbst hat mittlerweile ein KapMuG-Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beantragt.
Vergleiche nach dem WCAM sind nach der Rechtsprechung des Gerechtshof Amsterdam auch für Ansprüche nicht niederländischer Investoren gegen ein nicht niederländisches Unternehmen zulässig und erfolgen nach dem opt out-Prinzip. Geschädigte, die mit dem Vergleich nicht einverstanden sind, müssen diesen innerhalb einer bestimmten Frist ablehnen.
Die Stiftung vertritt Investoren, die Stammaktien, Vorzugsaktien, Rentenpapiere oder andere öffentlich gehandelte Wertpapiere der Volkswagen AG im Zeitraum vom 23. April 2008 bis 4. Januar 2016 erworben oder gehalten haben (ausgenommen sind in den USA gehandelte Papiere) und infolge des Abgasskandals Verluste erlitten haben.
Gegründet wurde die Stiftung von der US-amerikanischen Anwaltskanzlei, die Investoren, die ihre Volkswagen-Wertpapiere in den USA erworben haben, in einem Multi-District-Verfahren vor dem U.S. District Court, Northern District of California, nach US-amerikanischem Wertpapierrecht vertritt (In re: Volkswagen „Clean Diesel“ MDL, 15-MD-2672-CRB (JSC)). Diese Kanzlei finanziert auch die Kosten der Stiftung.
Am 18. September 2015 hatte die US-amerikanische Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) mitgeteilt, dass sie gegen die Volkswagen AG wegen Verstoßes gegen den Clean Air Act ermittele. Die Motorsteuerung der VW-Dieselfahrzeuge schaltete auf Prüfständen in einen optimierten Testmodus, um die US-amerikanischen Abgasnormen zu übergehen. Im Zuge dieses Abgasskandals verloren Volkswagenpapiere mehrere Millionen USD an Wert.
Bereits am 1. Oktober 2015 wurde am LG Braunschweig die erste Aktionärsklage gegen die Volkswagen AG wegen des Unterlassens rechtzeitiger Ad-hoc-Mitteilungen im Zusammenhang mit der Dieselaffäre anhängig gemacht (Az.: 5 O 2049/15). In ihrer Klageerwiderung vom 29. Februar 2016 weist die Volkswagen AG die Ansprüche zurück und beantragt die Durchführung eines Musterverfahrens nach dem KapMuG vor dem OLG Braunschweig.
USA – Fresenius schließt USD 250 Mio.-Vergleich wegen Dialyselösungen
Fresenius Medical Care North America, eine Tochtergesellschaft der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, hat am 17. Februar 2016 mitgeteilt, dass sie eine außergerichtliche Einigung in einem Multi-District-Verfahren wegen Personenschäden durch die Dialysepräparate Granuflo und NaturaLyte erzielt hat. Stimmen 97 % der Kläger bis Juli 2016 dem Vergleich zu, wird ihnen im August 2016 ein Gesamtbetrag von USD 250 Mio. ausgezahlt. Laut Presseberichten werden USD 220 Mio. von Versicherungen getragen.
Mit einem 6-seitigen internen Schreiben vom 4. November 2011 hatte Fresenius die Ärzte in den unternehmenseigenen Dialyse-Centern darauf hingewiesen, dass es 2010 in 667 der Kliniken in mindestens 941 Fällen zu plötzlichem Herzstillstand während Dialysebehandlungen gekommen war. Eine fehlerhafte Anwendung der von dem Unternehmen hergestellten Dialysepräparate erhöhe anscheinend das Risiko, dass die Patienten einen Kreislaufstillstand erleiden oder während bzw. kurz nach der Behandlung sterben, um das Sechs- bis Siebenfache. Die Ärzte sollten bei Anwendung von Granuflo-Pulver oder NaturaLyte-Lösung den Hydrogencarbonat-Spiegel im Blut ihrer Patienten überwachen. Andere Kliniken und Ärzte wurden von Fresenius nicht informiert.
Nachdem die U.S. Food and Drug Administration (FDA), der die interne Mitteilung anonym zugespielt worden war, eine Untersuchung begonnen hatte, versandte Fresenius am 29. März 2012 eine „Urgent Product Notification" an alle Kliniken, die die betreffenden Produkte nutzten. Die FDA bewertete dies als einen Rückruf der Klasse I, der schwerwiegendsten Kategorie. Die FDA veröffentlichte am 25. Mai 2012 einen Sicherheitshinweis zu Dialysekonzentraten, die Azetate, Essigsäure oder Citronensäure enthalten.
In der Folge wurden mindestens 4.300 Klagen von Patienten bzw. deren Angehörigen gegen Fresenius vor Bundesgerichten und hunderte weitere in Massachusetts und vor anderen staatlichen Gerichten erhoben. Die Streitigkeiten vor den Bundesgerichten wurden im April 2013 vor dem U.S. District Court, District of Massachusetts, zu einem Multi-District-Verfahren zusammengeführt (In Re: Fresenius Granuflo/Naturalyte Dialysate Products Liability Litigation, MDL 2428).
Die Kläger behaupten, dass sie bzw. ihre Angehörigen durch die Anwendung der streitgegenständlichen Dialyselösungen geschädigt wurden oder zu Tode gekommen seien. Die Produkte könnten eine metabolische Alkalose, d. h. einen Anstieg des Blut-pH-Werts auf über 7,43 bewirken. Dies führe bei den Patienten zu niedrigem Blutdruck, Kaliummangel, einem verringerten Sauerstoffgehalt und einem erhöhten Kohlendioxidgehalt im Blut, Herzrhythmusstörungen oder Kreislaufstillstand. Granuflo enthalte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine besonders hohe Menge an Natriumacetat, das vom Körper in Hydrogencarbonate umgewandelt wird und dadurch einen Anstieg der Hydrogencarbonate im Blut der Patienten bewirkt. Obwohl Fresenius das Risiko seit 2010 bekannt war, habe das Unternehmen erst auf Drängen der FDA einen Rückruf veranlasst.
USA – Vollzug von New Yorker Salz-Kennzeichnung für Restaurantketten ausgesetzt
Am 29. Februar 2016 hat die Appellate Division for the First Department des New York State Supreme Court wegen der Berufung der klagenden National Restaurant Association die Vollstreckung bei Verstößen gegen die am 1. Dezember 2015 geltende Salz-Kennzeichnung ausgesetzt. Der New York State Supreme Court, New York County (Manhattan) hatte am 24. Februar 2016 in der ersten Instanz die Salz-Kennzeichnung für wirksam erklärt (National Restaurant Association v. New York City Department of Health, Az.: 654024/2015).
Das New York City Department of Health hatte im September 2015 beschlossen, dass Restaurants in New York, die zu einer Kette mit mindestens 15 Filialen in den USA gehören, ab dem 1. Dezember 2015 auf ihren Speisekarten Gerichte, die mehr als 2,3 Milligramm Natrium enthalten, mit einem schwarzweißen Salzstreuer-Symbol kennzeichnen müssen. Ab dem 1. März 2016 wäre jeder Verstoß gegen diese Kennzeichnungspflicht mit einem Bußgeld von USD 200 belegt worden. Von der Kennzeichnungspflicht wären etwa ein Drittel aller New Yorker Restaurants und jedes zehnte Gericht auf deren Speisekarten betroffen.
2,3 Gramm Natrium entsprechen knapp sechs Gramm Salz (ein Teelöffel), die von der U.S. Food and Drug Administration empfohlene Tageshöchstmenge. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält diesen Grenzwert für angemessen, während die World Health Organization sogar nur fünf Gramm empfiehlt. Eine zu natriumreiche Ernährung kann zu erhöhtem Blutdruck führen und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle erhöhen. Herzerkrankungen sind in New York City der Grund für ein Drittel aller Todesfälle.
Die National Restaurant Association hatte gegen die Kennzeichnungspflicht u. a. mit der Begründung geklagt, dass diese Vorschrift nur vom New York City Council, dem Rat der Stadt New York, hätte verabschiedet werden dürfen und nicht eigenmächtig von der städtischen Gesundheitsbehörde. Die Pflicht basiere zudem auf einer wissenschaftlich umstrittenen Meinung und sei inkonsistent, da sie nicht alle Restaurants betreffe.
Der Supreme Court entschied, dass die Gesundheitsbehörde beim Erlass der Kennzeichnungspflicht nicht außerhalb ihrer Zuständigkeit gehandelt habe. Es handele sich auch nicht um ein Verbot, sondern lediglich um eine Information bzw. einen Warnhinweis.
Die Entscheidung des Appellate Courts wird gegen Ende März 2016 erwartet. Die Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass auch das Berufungsgericht die Kennzeichnungspflicht bestätigen wird, und spricht daher weiterhin Verwarnungen gegenüber Kettenrestaurants aus, die sich nicht an die Kennzeichnungspflicht halten.
Bereits seit 2006 dürfen Kettenrestaurants in New York keine Transfette mehr verwenden und müssen seit 2008 den Kaloriengehalt ihrer Gerichte angeben. Das 2013 in Kraft getretene Verbot des Verkaufs von Softdrinks in einer Größe von mehr als 0,5 Litern wurde hingegen 2014 vom New York Court of Appeals, dem höchsten New Yorker Gericht, verworfen.
Vereinigtes Königreich – Gesetzentwurf zur Kennzeichnung und Bewerbung von zuckerhaltigen Lebensmitteln
Am 21. Oktober 2015 wurde die „Sugar in Food and Drinks (Targets, Labelling and Advertising) Bill 2015“ in das Parlament des Vereinigten Königreichs eingebracht. Mit dem Gesetz sollen u. a. die verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften des § 16 des Food Safety Act 1990 um Vorschriften zur Kennzeichnung zuckerhaltiger Lebensmittel ergänzt werden.
Künftig soll der Zuckergehalt von Lebensmitteln und Getränken auf der Verpackung in Teelöffel-Einheiten angegeben werden. Ein Teelöffel entspricht dabei vier Gramm Zucker. Des Weiteren soll der Zuckergehalt von Lebensmitteln in jeglichem Werbematerial aufgeführt werden. Lebensmittel, deren Zuckergehalt 20 % übersteigt, dürfen nicht als „gesund“ oder „fettarm“ beworben werden.
Neben der Sugar Bill sind außerdem eine „sugar tax“, eine Steuer von 20 % auf zuckerhaltige Getränke und Süßigkeiten, sowie ein Werbeverbot für ungesundes Essen während Fernsehsendungen für Kinder geplant. Die Werbevorschriften für Lebensmittel mit hohen Fett-, Salz- und Zuckeranteil waren bereits 2007 verschärft worden.
Gegen die Sugar Bill bestehen EU-rechtliche Bedenken. Zum einen sind nationale Maße wie die vorgeschlagenen Teelöffel-Einheiten nur zulässig, wenn sie nicht den freien Warenhandel beeinträchtigen, es sei denn sie werden von der EU-Kommission aus Gesundheits- oder Verbraucherschutzgründen akzeptiert. Zum anderen könnten die Werbebeschränkungen für Lebensmittel mit einem Zuckergehalt über 20 %, die vor allem Unternehmen treffen, die Sportlernahrung, Getränke und Milchprodukte vertreiben, ebenfalls als Einschränkung des freien Warenhandels EU-rechtswidrig sein.
Vereinigtes Königreich – Schottisches Recyclingunternehmen muss GBP 345.558,43 zahlen
Am 15. Februar 2016 ordnete die Scottish Environment Protection Agency (SEPA) gegen das schottische Recyclingunternehmen Oran Environmental Solutions Ltd. (OES) den Verfall von GBP 345.588,43 an. Außerdem wurden gegen das Unternehmen drei Bußgelder in Höhe von insgesamt GBP 12.000 verhängt.
Bei dem Verfallsbetrag gemäß dem Proceeds of Crime Act 2002 und Proceeds of Crime (Scotland) Act 1995 (POCA) handelt es sich um den höchsten Betrag, der bislang in Schottland wegen eines Verstoßes gegen Genehmigungen nach dem Environmental Protection Act 1990 verhängt wurde.
OES betreibt eine Deponie in Kilbargie Mill in Alloa, auf der sie Abfall sammelt und Pappe, Papier, Aluminium, Holz und Metalle recycelt. Als diese Deponie im Jahr 2013 überfüllt war, verlagerte das Unternehmen Abfall in andere Bereiche des Firmengeländes, die nicht als Deponie genehmigt waren. Der Abfall wurde dort in nicht abgetrennten Halden, Containern und Behältern gelagert. Auf den durchlässigen Untergrund lief übelriechendes und umweltschädliches Sickerwasser. Zahlreiche Anwohner beschwerten sich über das vermehrte Auftreten von Ungeziefer, Fliegen und Vögeln.
Im Mai 2013 forderte die SEPA das Unternehmen auf, die keine weiteren Abfälle mehr anzunehmen und die nicht genehmigten Müllhalden zu entfernen. Als OES dem nicht nachkam, entzog die SEPA ihr teilweise die abfallwirtschaftliche Genehmigung für die Deponie, um die Annahme weiterer Abfälle zu verhindern, und erzwang die Entfernung des Abfalls von den ungenehmigten Bereichen des Geländes.
Am 16. Februar 2015 bekannte sich OES der Zuwiderhandlung gegen behördliche Anweisungen in drei Fällen für schuldig, mit der Folge, dass gegen das Unternehmen drei Bußgelder in Höhe von insgesamt GBP 12.000 verhängt wurden. Mit dem sodann am 15. Februar 2016 angeordneten Verfall von GBP 345.588,43 sollen die Kosten und Gebühren abgeschöpft werden, die OES durch ihre gesetzwidrigen Handlungen einsparen wollte.
Ausgabe von Januar 2016
Deutschland – BGH: Beweissicherung im Arzthaftungsverfahren dient nicht der Ausforschung
Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass in einem selbständigen Beweisverfahren zu möglichen Behandlungsfehlern das minimale Maß an Substanziierung hinsichtlich der Beweistatsachen jedenfalls dann nicht erreicht ist, wenn der Antragsteller in lediglich formelhafter und pauschaler Weise Tatsachenbehauptungen aufstellt, ohne diese zu dem zugrunde liegenden Sachverhalt in Beziehung zu setzen (Beschluss vom 10. November 2015, Az. VI ZB 11/15).
Die Antragstellerin wollte im selbständigen Beweisverfahren elf Operationen ihres rechten Knies, die im Zeitraum vom 15. September 2009 bis 7. März 2013 durchgeführt worden waren, begutachten lassen. Zu jeder Operation stellte sie einen Katalog von Beweisfragen an Sachverständige sechs verschiedener medizinischer Fachrichtungen, darunter folgende:
1. a) War die Operation indiziert? Wenn ja, welche Indikation lag der Operation zugrunde? Ist das ordnungsgemäß dokumentiert?
b) Gab es andere Möglichkeiten der Therapie, konnte die Operation vermieden werden? Ist das ordnungsgemäß dokumentiert?
c) Über welche Behandlungsmöglichkeiten ist aufzuklären? Ist über diese Behandlungsmöglichkeit aufgeklärt worden; wenn ja, wie? Ist das ordnungsgemäß dokumentiert?
Insgesamt stellte die Antragstellerin 374 Beweisfragen.
Das Landgericht Heilbronn und das Oberlandesgericht Stuttgart sahen den Antrag als unzulässig an. Der BGH wies die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zurück.
Nach der Auffassung des BGH ist der Antrag unzulässig, weil die Antragstellerin entgegen § 487 Nr. 2 ZPO die Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll, nicht bezeichnet hat. Zwar ergäben sich aus dem besonderen Charakter des selbstständigen Beweisverfahrens und dem mit ihm verfolgten Zweck, einen Rechtsstreit zu vermeiden, möglicherweise niedrigere Anforderungen an die Darlegungslast. Doch auch wenn die Angabe der Beweistatsachen in groben Zügen ausreichen sollte, sei ein Minimum an Substanziierung in Bezug auf die Beweistatsachen zu fordern, damit der Verfahrensgegenstand zweifelsfrei abgrenzbar ist und der Sachverständige eine Grundlage für die ihm übertragene Tätigkeit hat.
Die Antragstellerin habe hingegen die zu jeder der elf Operationen aufgestellten Behauptungen jeweils wortgleich, ohne Einzelfallbezug, formelhaft und zudem so formuliert, dass sie jedes mögliche Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Behandlung der Antragstellerin erfassen sollten. So berücksichtigten die Behauptungen der Antragstellerin beispielsweise nicht, dass die verschiedenen Operationen aus unterschiedlichen Gründen erfolgt waren. Vielmehr brachte sie u. a. vor, die Operationen, die alle nicht indiziert gewesen wären, hätten bei ihr eine Nickelallergie ausgelöst, obwohl diese Allergie erst im Laufe der Krankengeschichte diagnostiziert worden war.
Der BGH stellte klar, dass eine Bezugnahme auf die dem Antrag beigefügten umfangreichen Krankenunterlagen nicht ausreicht. Anlagen können schriftsätzliches Vorbringen nicht ersetzen, sondern lediglich erläutern. Das Beschwerdegericht sei insbesondere nicht gehalten gewesen, die in sieben Anlagebänden enthaltenen Behandlungsunterlagen daraufhin durchzusehen, ob sich ihnen ausreichende Beweistatsachen entnehmen lassen.
Es handelt sich somit nicht um Beweisfragen i. S. des § 487 Nr. 2 ZPO, sondern es wurde auf eine umfassende Überprüfung der Krankengeschichte der Antragstellerin abgestellt, durch die der maßgebliche Sachverhalt erst ermittelt werden sollte.
Europa/Deutschland – Gesetzentwurf zu Anbauverboten von GVO
Die Bundesregierung hat dem Bundestag am 11. November 2015 einen Gesetzentwurf des Bundesrats zur Umsetzung der EU-Opt-out-Richtlinie vorgelegt (BT-Drs. 18/6664). Dem Entwurf ist die noch nicht abschließende Stellungnahme der Bundesregierung beigefügt.
Die Opt-out-Richtlinie (2015/412/EU) vom 11. März 2015 sieht die Möglichkeit vor, dass EU-Mitgliedstaaten nationale Anbauverbote oder Beschränkungen für gentechnisch veränderte Pflanzen beschließen dürfen.
Gemäß dem neuen § 16f Abs. 5 GenTG-E soll die Bundesregierung [sic] den Anbau eines gentechnisch veränderten Organismus (GVO) oder einer Gruppe von nach Kulturpflanzen oder Merkmalen festgelegten gentechnisch veränderten Organismen durch eine ggf. mit Bußgeld bewehrte Rechtsverordnung im gesamten Hoheitsgebiet beschränken oder untersagen, sofern die Beschränkung bzw. das Verbot im Einklang mit dem Recht der EU steht, begründet, verhältnismäßig und nicht diskriminierend ist und sich auf zwingende Gründe stützt. Zwingende Gründe betreffen entsprechend der Richtlinie insbesondere umweltpolitische Ziele, Stadt- und Raumplanung (jedoch keine bloße Verhinderungsplanung), Bodennutzung (z. B. der Erhalt der Kulturlandschaft), sozioökonomische Auswirkungen (hier ist eine Abwägung der Vor- und Nachteile erforderlich, um den Interessen der Landwirte und Verbraucher gebührend Rechnung zu tragen), Verhinderung des Vorhandenseins von GVO in anderen Erzeugnissen, agrarpolitische Ziele (u. a. Schutz der Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktion und der Reinheit des Saatguts sowie des Pflanzenvermehrungsmaterials), Wahrung der öffentlichen Ordnung oder sonstiger wichtiger Gründe des Allgemeinwohls (z. B. kulturelle Traditionen).
Die Maßnahmen dürfen gem. § 16f Abs. 8 GenTG-E nicht den freien Verkehr von GVO als Erzeugnis oder in Erzeugnissen beeinträchtigen.
Der Entwurf des Bundesrats sieht in § 16f Abs. 9 GenTG-E vor, dass die Vorschriften über die Anbaubeschränkungen und -verbote nicht für den Anbau zugelassener gentechnisch veränderter Organismen zu Forschungszwecken gelten, wenn durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt ist, dass keine Ausbreitung von GVO stattfinden und kein Eintrag von Bestandteilen von GVO in die Lebensmittelkette erfolgen kann. Die Bundesregierung hat hingegen in ihrer Stellungnahme klargestellt, dass sie die zusätzliche Vorgabe von Sicherheitsvorkehrungen nicht für geboten hält und § 16f Abs. 1 - 8 GenTG-E somit insgesamt nicht für den Anbau von zugelassenen GVO gelten sollen, sofern der Anbau zu Forschungszwecken erfolgt.
Österreich – OGH: Maschinen-Sicherheitsverordnungen schützen auch Dritte
Der österreichische Oberste Gerichtshof hat klargestellt, dass die Maschinen-Sicherheitsverordnungen den Schutz von Sicherheit und Gesundheit von Personen allgemein und nicht nur von Verwendern der jeweiligen Erzeugnisse bezwecken (Beschluss vom 28. Oktober 2015, Az. 9 Ob 59/15i).
Am 22. Januar 2010 hatte der damals zwei Jahre und vier Monate alte Kläger in eine nicht abgedeckte Öffnung hinter der Anhängerkupplung eines in Betrieb befindlichen Holzrückewagens gegriffen, wodurch sein linker Arm von der hinter der Öffnung rotierenden Zapfwelle erfasst und abgerissen wurde. Der Arm musste amputiert werden. Die Öffnung, die einen Durchmesser von etwa 10 cm hatte, diente der (De-)Montage und Wartung der Gelenkwelle des von der Beklagten hergestellten Wagens.
Das Oberlandesgericht Linz hatte das Begehren des Klägers auf Zahlung eines Schmerzensgelds in Höhe von EUR 50.000 wegen eines Produktfehlers i. S. des § 5 Abs. 1 öPHG als dem Grunde nach zu Recht bestehend erachtet und seinem Begehren auf Feststellung der Haftung der Beklagten für alle künftigen Schäden aus dem Unfall stattgegeben.
Die außerordentliche Revision der Beklagten wies der öOGH wegen des Fehlens einer erheblichen Rechtsfrage i. S. von § 502 Abs. 1 öZPO zurück.
Der Zeitpunkt des In-Verkehrs-Bringens gem. § 6 öPHG stehe zwar nicht fest, aber da der Anschlussbereich der Zapf- und Gelenkwelle aufgrund der Öffnung des Schutzgehäuses nicht wie von § 99 Maschinen-Sicherheitsverordnung (MSV – bis 28. Dezember 2009 geltend) bzw. Punkt 3.4.7. des Anhangs I der Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 (MSV 2010 – in Kraft seit 29. Dezember 2009) über ihre gesamte Länge so verdeckt war, dass es während des aufrechten Betriebs zu keinen Einwirkungen von außen kommen konnte, erfüllte die Konstruktion nicht die Anforderungen der MSV bzw. MSV 2010. Die Formulierung von Punkt 3.4.7. dritter Absatz des Anhangs I MSV 2010 weise zudem auf die prinzipielle Unzulässigkeit einer nicht verschließbaren Zugangsmöglichkeit hin. Eine (abnehmbare) Abdeckung erhöhe das Sicherheitsbewusstsein nicht nur bei Dritten, sondern auch beim Verwender und erfülle somit eine Warnfunktion.
Entgegen der Meinung der Beklagten seien die Verordnungen auch auf den minderjährigen Kläger anwendbar.
Die frühere MSV sowie die dieser zugrunde liegende Richtlinie 98/37/EG enthielten keine Einschränkung auf die Verwender der Erzeugnisse. Geschützt seien also nicht nur die Verwender der Maschinen, sondern auch andere Personen, bei denen sich gerade die Gefahr des fehlenden Sicherheitsstandards verwirklicht.
Auch bei der MSV 2010, die ihren Anwendungsbereich nur noch auf bestimmte Erzeugnisse beziehe, sei erkennbar, dass sie darauf abziele, bei bestimmungsgemäßer und vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen und ggf. von Haustieren und Sachen und, soweit anwendbar, die Vermeidung einer Umweltgefährdung zu gewährleisten.
Da sich beim Kläger gerade das Risiko aus dem produktspezifischen Fehler (Gefahr des offenen Lochs bei laufender Welle) verwirklicht habe, bestehe zur Beurteilung des Berufungsgerichts insgesamt kein Korrekturbedarf.
Polen – Oberstes Gericht bestätigt Haftung gerichtlicher Sachverständiger
Das Sąd Najwyższy, das höchstinstanzliche ordentliche Gericht in Polen, hat entschieden, dass gerichtlich bestellte Sachverständige für falsche gutachterliche Äußerung haften (Entscheidung vom 29. Mai 2015, Az. V CSK 479/15). Der Geschädigte hat bei einem falschen Gutachten also nicht nur Ansprüche aus Staatshaftung, sondern kann auch den Sachverständigen in Anspruch nehmen.
Im der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war die gerichtliche Sachverständige in einem Rechtsstreit zwischen Bauherrn und Bauunternehmer zu dem Schluss gekommen, dass die streitigen Bauarbeiten fehlerfrei und entsprechend dem Entwurf ausgeführt worden waren. Der Bauherr, der aufgrund dieses Gutachtens verurteilt wurde, dem Bauunternehmer die geforderte Vergütung zu zahlen, verklagte in der Folge die Sachverständige auf Schadensersatz.
Das Oberste Gericht stellte klar, dass die Haftung eines gerichtlich bestellten Sachverständigen unabhängig ist von einer etwaigen Haftung des Staates für ein aufgrund eines falschen Gutachtens erlassenes rechtskräftiges Fehlurteil. Das polnische Verfassungsgericht hatte bereits in einem früheren Urteil entschieden, dass der Sachverständige für seine Handlungen auch dann verantwortlich bleibt, wenn er durch ein Gericht bestellt wurde. Die Haftung des Sachverständigen für ein fehlerhaftes Gutachten wird also nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Gutachten vom Gericht ausgelegt wurde, und auch nicht dadurch, dass das aufgrund des mangelhaften Gutachtens ergangene Urteil wirksam ist.
Das Oberste Gericht führte aus, dass ein Gutachten dann falsch ist, wenn es in offensichtlichem Widerspruch zur Sachlage oder dem aktuellen Wissensstand im entsprechenden Fachgebiet steht oder auf einer eindeutig falschen Untersuchungsmethode basiert. Ein Gutachten ist außerdem fehlerhaft, wenn der Sachverständige falsche Informationen verbreitet, Schlüsse aus Tatsachen zieht, die eindeutig unvereinbar sind mit im betreffenden Fachgebiet unstreitigen Kriterien oder wesentliche Untersuchungsergebnisse verschweigt.
Rechtlicher Hinweis
Alle hier enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch wird für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernommen. Insbesondere stellen diese Information keine Rechtsberatung dar und können eine solche auch nicht ersetzen.